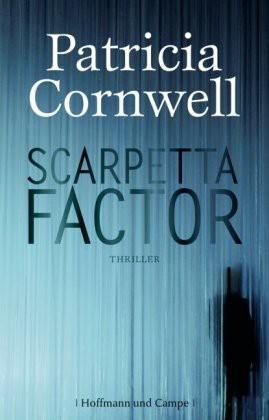![Scarpetta Factor]()
Scarpetta Factor
zwar in der Barrow Street im Greenwich Village, genau genommen im West Village. Das zweistöckige Bauwerk im romanischen Stil hatte Bogenfenster und stand, ebenso wie das frühere Kutschhaus nebenan, das Lucy im letzten Frühjahr gekauft hatte und als Garage nutzte, unter Denkmalschutz.
Als Hausbesitzerin war Lucy der Traum jeder Denkmalschutzkommission, weil sie nicht das geringste Interesse hatte, etwas am Äußeren des Gebäudes zu verändern. Sie hatte nur winzige Anpassungen vorgenommen, die für ihre zahlreichen Computer und Überwachungskameras nötig waren. Noch wichtiger für besagte auf Spendengelder angewiesene Organisation war Lucys Großzügigkeit, die allerdings auch eigennützige Motive hatte. Berger glaubte ohnehin nicht daran, dass jemand aus reiner Menschenfreundlichkeit handelte, ohne sich einen Vorteil davon zu versprechen. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Lucy gespendet hatte, um einige Interessenkonflikte aus dem Weg zu räumen, und ihr Unwissen wurmte sie sehr. Lucy hätte keine Geheimnisse vor ihr haben dürfen, doch sie hatte welche, und in den letzten Wochen war es mit ihrer Verschwiegenheit immer schlimmer geworden. Berger bekam, was ihre Beziehung anging, zunehmend ein mulmiges Gefühl, das sich von ihren bisherigen Zweifeln unterschied.
»Vielleicht sollten Sie es sich in die Hand tätowieren lassen.« Lucy streckte die Handfläche aus. »Als Stichwort sozusagen.
Schauspieler brauchen doch Stichwörter. Alles eine Frage der Umstände .« Sie tat, als läse sie etwas von ihrer Handfläche ab. »Lassen Sie sich Alles eine Frage der Umstände eintätowieren, und schauen Sie es sich jedes Mal an, wenn Sie vorhaben zu lügen.«
»Ich habe keine Stichwörter nötig, und ich lüge nicht«, entgegnete Hap Judd, um Haltung bemüht. »Die Leute reden so manches daher, was nicht unbedingt heißen muss, dass sie Dreck am Stecken haben.«
»Ich verstehe«, erwiderte Berger und wünschte, Marino würde sich beeilen. Wo zum Teufel steckte er bloß? »Bedeutet das, dass es eine Frage der Umstände ist, wie man – in diesem Fall ich – die Äußerungen auslegt, die Sie am vergangenen Montagabend, am 15. Dezember also, in einer Bar gegenüber Eric Mender gemacht haben? Sie sagten zu ihm, es sei für Sie nachvollziehbar, dass man sich für ein neunzehnjähriges Mädchen im Koma interessieren, sie nackt sehen wollen und vielleicht sogar Lust haben könnte, sie sexuell zu berühren. Und das soll Interpretationssache sein? Ich überlege immer noch, wie ich eine derart beunruhigende Bemerkung sonst deuten soll.«
»Gütiger Himmel, das versuche ich Ihnen doch die ganze Zeit klarzumachen. Eine reine Frage der Sichtweise. Es ist nicht ... es ist nicht so, wie Sie denken. Ihr Foto war überall in den Nachrichten. Und ich habe damals zufällig in dem Krankenhaus gearbeitet, in dem sie lag«, protestierte Judd, schon ein bisschen weniger gelassen. »Ja, ich war neugierig. Jeder ist neugierig, wenn er ehrlich mit sich ist. Mein Leben wird von Neugier bestimmt, und zwar auf alle möglichen Sachen. Aber das heißt nicht, dass ich etwas angestellt habe.«
Hap Judd wirkte nicht wie ein Filmstar. Er war nicht der Typ, dem man Rollen in aufwendigen Produktionen wie Tomb Raider oder Batman gegeben hätte. Berger wurde diesen Gedanken nicht los, seit sie ihm an dem Konferenztisch aus gebürstetem Edelstahl in Lucys scheunenähnlichem Büro mit den frei liegenden Deckenbalken, dem mit Tabak gebeizten Holzboden und den Computer-Flachbildschirmen, die schlafend auf papierlosen Schreibtischen standen, gegenübersaß. Hap Judd war durchschnittlich groß, sehnig, ja, beinahe zu mager und hatte unauffälliges braunes Haar und braune Augen. Sein Gesicht war makellos und ebenmäßig, aber ohne Ausdruck, eine Eigenschaft, die auf der Leinwand gut wirkte, im tatsächlichen Leben jedoch keinen sehr anziehenden Eindruck machte. Wäre er der nette Junge von nebenan gewesen, Berger hätte ihn als ordentlich gekleidet und ansprechend beschrieben.
Seit einer halben Stunde setzte Lucy ihm nun schon zu, und zwar auf eine Art und Weise, die Berger ziemlich zu denken gab. Wo zum Teufel steckte Marino? Er hätte längst hier sein müssen. Eigentlich hätte er, nicht Lucy, sie bei der Vernehmung unterstützen sollen. Sie war kaum noch zu bändigen und verhielt sich, als habe sie eine persönliche Fehde mit dem Mann auszutragen. So als hätten sie eine gemeinsame Vergangenheit. Vielleicht traf das ja auch zu. Immerhin hatte Lucy Rupe
Weitere Kostenlose Bücher