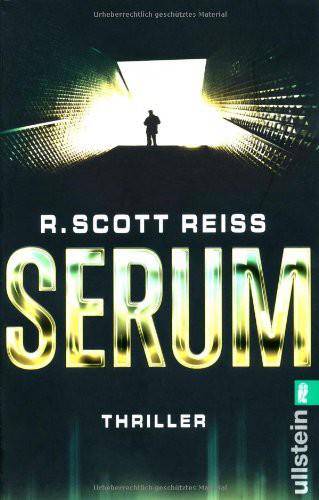![Serum]()
Serum
Spielchen. Büropolitik war mir schon immer ein Greuel gewesen. Kranz’ Stimme triefte von geheuchelter Kameradschaft. »Wir sind uns doch einig, dass ein gewisses Image …«
Ich schnitt ihm das Wort ab, indem ich mich an Hoot wandte.
»Wenn dir wieder mal jemand außer mir irgendwelche Anordnungen erteilen will, ignorier ihn einfach. Du arbeitest für mich. Ausschließlich.«
Hoot setzte sich etwas aufrechter hin.
Ich fügte hinzu: »Kranz hat dir nichts zu sagen. Du hättest jederzeit gehen können.«
Sie blickte zwischen mir und Kranz hin und her. Dann lächelte sie. Es war ein hübsches Lächeln.
Kranz wirkte konsterniert. Seine Untergebenen konnten einem leidtun. Ich sagte: »Ralph, Hoot wurde engagiert, um Hacker aus unserem System fernzuhalten. Bei Ihnen hat sie eine Sicherheitslücke entdeckt, also hat sie gute Arbeit geleistet. Im Gegensatz zu Ihnen.«
»Sie … Ich will vor einer solchen Überprüfung gefragt werden.«
»Die Hacker bitten auch nicht erst um Erlaubnis, oder?«
Hoot schnaubte belustigt, und Kranz lief puterrot an. »Das ist keine Art, mit Leuten zu reden«, sagte er.
»Genau darauf wollte ich hinaus.«
Ich sagte Hoot, es sei Zeit, zu gehen. Wir ließen Kranz sprachlos im Konferenzraum stehen, beschämt und vor Wut schnaubend.
»Tut mir leid, wenn ich Sie in Schwierigkeiten gebracht habe«, meinte Hoot im Aufzug. Aber eigentlich wirkte sie sehr aufgekratzt. Für die Moral in der Abteilung konnte man sich schon mal einen Feind machen.
»Beim nächsten Mal fragst du vorher«, ordnete ich an. »Aber das war verdammt gute Arbeit.« Endlich kam ich dazu, mir die Akte anzusehen. Ich überblätterte ein paar andere Projekte, bis ich HF-109 fand. Ich wusste immer noch nicht, ob es auch nur das Geringste mit dem Tod des Vorsitzenden zu tun hatte.
»Es geht um einen Fisch«, informierte mich Hoot. Ich las, dass der Initiator des Projekts ein freier Mitarbeiter aus Key West namens Asa Rodriguez war. »Ist das nicht komisch? Ein ganzes Projekt nur über einen einzigen tropischen Fisch.«
Ein Fisch passt zu Naturetech, dachte ich.
Die Aufzugtür glitt auf. Hoot und ich traten in die Lobby hinaus.
»Ein Fisch …« Anscheinend hatte Lenox Asa Rodriguez ein kleines Forschungsstipendium für die Suche nach einem bestimmten Fisch gewährt, dessen wissenschaftlichen Namen ich nicht einmal aussprechen konnte.
»Er produziert ein Gift in seinen Flossenstacheln«, meinte Hoot, während sie auf die Skizze eines kleinen, schlanken Fisches mit einem Haufen karminroter Stacheln am Rücken zeigte. »Aber es ist nicht nur tödlich für die Feinde dieses Fisches, es soll auch gegen Arthritis wirken. Jedenfalls theoretisch. Es hat nicht funktioniert.«
Mein Blick fiel auf den Namen des Labors, wo man die Arthritis-Tests durchgeführt hatte.
»Naturetech« ,sagte ich. »Verdammt.«
Wie konnte Dr. Teaks dann behaupten, er hätte nie von HF-109 gehört?
Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte nichts im Magen. Ich war müde und sah die Verbindung zu Dwyers Tod nicht.
Lenox finanzierte ständig – allein oder mit Partnern – mehr als tausend Projekte auf der Suche nach neuen Medikamenten. Weniger als ein halbes Prozent davon hatte Erfolg.
Was sollte ein seltener Fisch mit Dwyers Tod zu tun haben?
Der Kopf schwirrte mir von unbeantworteten Fragen. War es möglich, dass das HF-109-Projekt immer noch lief und aus diesem Grund die Akte fehlte und Teaks gelogen hatte?
Eine Firma, die ein Heilmittel gegen Arthritis fand, würde ein Milliardengeschäft machen, und ebenso die Investoren und Wissenschaftler, die am Gewinn beteiligt waren.
Aber was sollte das Militär an der Arthritisforschung interessieren? Das ergab keinen Sinn.
Ich verabschiedete mich von Hoot, ging zu meinem Wagen in der Tiefgarage und hörte die Mailbox ab. Carl Eisner hatte noch zweimal angerufen und klang zunehmend verärgert.
»Sie sollten wirklich zurückrufen«, sagte er in der letzten Nachricht, die mehr wie eine Drohung klang.
Das würde ich tun, aber erst wenn ich die Akte gründlicher studiert hatte. Als ich sie aufschlug, sah ich wieder den Schimpansen in seinem Käfig in Maryland vor mir. Ein dem Untergang geweihtes Geschöpf – vielleicht absichtlich mit einer schrecklichen Krankheit infiziert –, das Trost suchte und nur kalte Gitterstäbe fand.
Natürlich rief Gabrielle Dwyer an, bevor ich anfangen konnte zu lesen.
»Es ist zwanzig nach acht. Ich bin im Restaurant. Ich bin müde und hatte einen schlechten Tag.«
Sie
Weitere Kostenlose Bücher