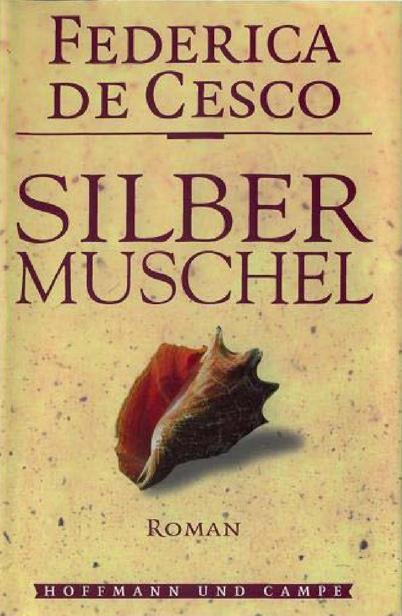![Silbermuschel]()
Silbermuschel
meistens jedoch lauerte sie – wie ein Schatten – in tieferen Schichten. Es war ein Gefühl, das sich kaum beschreiben läßt: als ob ich etwas ganz Wichtiges tun müßte. Etwas, das keinen Aufschub duldete. Ich konnte nicht herausfinden, was diese Sache, die ich tun mußte, eigentlich war. Das machte mich fast verrückt. Es war für mich die Ursache einer dauernden Nervosität, ein anhaltendes Ärgernis. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Es war wie ein Gespenst, das mich unnachsichtig verfolgte. Ich suchte nach Möglichkeiten, diesem Gespenst in mir zu entkommen, doch in meiner Beschränktheit fand ich nur wenig und fragwürdige Ablenkung. So geriet ich in die sogenannte Szene. Besser gesagt, ich versank darin wie in einem Schlammloch, mit Alkohol, Hasch und manchmal auch härteren Sachen. Die Wirkung war sofort fühlbar: Kaum war ich geladen, sah ich Dinge, die ich nicht sehen wollte: sterbende Pferde, Gedärmehaufen, Suchschweinwerfer oder weiße Regenbögen. Mit Alkohol verstärkt, gewannen diese Bilder an Intensität. Ich hing nächtelang in Bars herum und wachte mit flauem Kopf auf; meine Unruhe aber wühlte im Verborgenen weiter. In dieser Zeit trieb ich mich nicht in der feinsten Gesellschaft herum, und meine Neigung zu Handgreiflichkeiten machte die Sache nicht besser, ich entdeckte in mir eine erschreckende Fähigkeit zum Zorn, zu düsteren, tückischen 369
Gewaltausbrüchen. Ich fühlte, daß ich beliebig viel Unheil anrichten konnte. Daß ich die Macht hatte, wählen zu können: Gut oder Böse. Und auch, daß das Böse nicht ohne Anziehungskraft war. Ich war ein Fremder, ein Eindringling in meinem eigenen Gewissen. Wo beginnt die Gewalt? Wo endet sie? Gewalt beruht nicht auf Unabsichtlichkeit: Jeder trägt sie im Herzen. Keiner ist unschuldig; keiner geht durch die Welt, ohne mit ihr in Berührung zu kommen.
Ich betrachtete mich im Spiegel, kam mir schmutzig und verachtenswert vor.
Meine Ansprüche an das Böse waren mit Weltschmerz vermischt. Ich stellte fest, daß ich bis jetzt in meinem Leben noch nichts Vernünftiges zustande gebracht hatte. So brauchte ich Menschen um mich, egal welche; wenn sie mich nur am Denken hinderten. Mich bedrohte eine psychische Auflösung, eine Zersetzung.
Alkohol, Drogen oder eine intensive und gefahrvolle Betätigung – zu schnelles Autofahren etwa – lenkten meine Wahrnehmungsfähigkeit in eine Richtung, die ich als falsch ansah. Aber ich wußte nicht, in welcher Richtung ich das Bessere suchen mußte. Und irgendwie hing das alles damit zusammen, daß ich Isamis Buch verloren hatte. Selbst die Worte, die sie mir als Geleit mitgegeben hatte, waren mir entfallen. In meiner Erinnerung suchte ich vergeblich danach. Manchmal wachte ich auf, und ihr Klang verblaßte gerade. Irgendwo in mir waren diese Worte, doch sie drangen nicht bis zu meinem Hirn vor. Es war, als ob Isami mir ihre schützende Hand entzogen hätte. Mein Herz pochte von meinem eigenen Zorn, und das Böse war eine tückischlockende Kraft.
Ich mußte das Ding aus dein Leib reißen, mußte diesen Schatten tilgen, mich von diesem Eindringling befreien, meine Seele reinigen. Eine ewige Sucht nach Bewegung plagte mich. Manchmal schien es, als würden die Tage nie enden; und wenn die Nacht kam, lag ich wach und zählte die Stunden bis zum Morgen. Im Bett fühlte ich mich ungemütlich; ich zog es vor, draußen zu bleiben, lief nächtelang herum. Nur wenn ich total betrunken oder benebelt war, schlief ich ein.
Aber am nächsten Tag ging es mir nur schlimmer. Ein Lied aus jener Zeit, das in jeder Juke-Box zu hören war, ist mir noch in Erinnerung: A tenement, a dirty street. The days of Pearly Spencer, her race is almost run…
So war es. Und dann wurde es Juli. Und es wurde August. Der Vollmond schien, und jede Nacht fuhr ich nach Arles. Vielleicht, weil ich Isamis Buch dort gefunden hatte. Ich hatte es mir gekauft. Aber es war nicht das Buch, das ihre Hände berührt, nicht die Schrift, die ihr Geist beseelt hatte. Es war wie der Abglanz eines Sterns, längst geplatzt und gestorben, ein Stern, dessen Schimmer erst nach Jahrmillionen die Erde erreicht. Es war der Widerschein eines Widerscheins, nichts anderes als ein Phantom.
Der Mond schien mir grell und schmerzend in die Augen. Er leuchtete nicht wie in Japan sanft und golden. In unserer feuchten Luft erscheinen alle Dinge verschwommen; eine geheimnisvolle Aura umhüllt auch das Mondlicht. Die sanften Strahlen erwecken in uns den Wunsch, ganz
Weitere Kostenlose Bücher