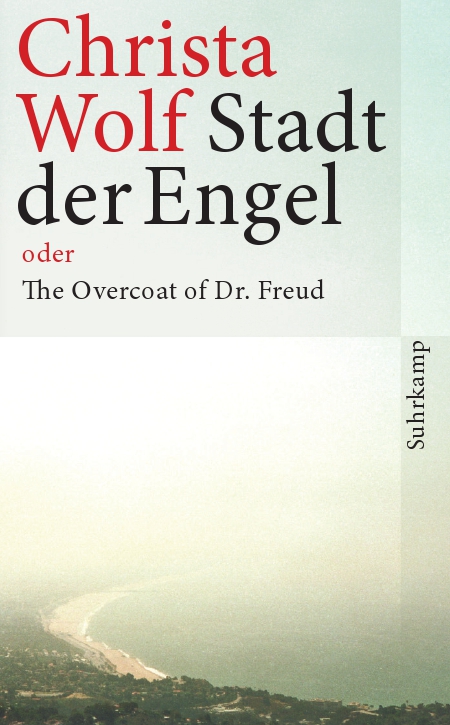![Stadt der Engel]()
Stadt der Engel
Amerikaner nahmen uns als erste Besatzungsmacht in Empfang, dann kontrollierten die Engländer den Zipfel Mecklenburgs, in dem wir untergekommen waren. Aber am Ende, im selben Sommer noch, waren es eben doch die sowjetischen Truppen, die verabredungsgemäß bis zur Elbe vorrückten. Die ihre Ordnung in dem östlichen Teil Deutschlands errichteten, in die ich hineinwuchs und in der ich wie selbstverständlich lebte. Es war um Stunden gegangen: Wären die Pferde des Gutsbesitzers, auf dessen Wagen wir hockten, nicht so ausgepumpt gewesen, daß sie selbst durch Peitschenhiebe nicht mehr anzutreiben waren – ich hätte ein vollkommen anderes Leben gelebt. Ich wäre einanderer Mensch geworden. So war das damals in Deutschland, ein Zufall hatte dich in der Hand.
Und? fragte Peter Gutman. Möchtest du zurück? Den Zufall korrigieren? Die Elbe diesmal überschreiten? Der andere Mensch sein, der du dann geworden wärst?
Wahrscheinlich wäre ich Lehrerin geworden, wie ich es eigentlich wollte. Ob ich geschrieben hätte, weiß ich schon nicht, denn zum Schreiben haben mich ja immer die Konflikte getrieben, die ich in dieser Gesellschaft hatte. Meinen Mann hätte ich nicht kennengelernt. Andere Kinder, oder keine. Andere Eigenschaften hätte ich in mir hochkommen lassen, andere unterdrücken müssen. Hätte ich in einem Reihenhaus am Rand einer großen Stadt gelebt? Welche Partei gewählt? Wäre mein Leben langweilig gewesen? Für die Achtundsechziger wäre ich zu alt gewesen. In den Osten wäre ich nicht gegangen. Meine Urlaube hätte ich in Italien verbracht. Jetzt, als die Mauer fiel, wäre ich als Fremde in ein fremdes Land gekommen, in dem auch Deutsch gesprochen wurde, in dem ich die Leute aber nicht verstanden hätte. Weil ich gedacht hätte, das Leben, das ich, das wir geführt hatten, sei das eigentlich normale. Und ich wäre ohne Schuld gewesen.
Okay, sagte Peter Gutman. Das reicht.
Er ging. Ich war noch nicht müde, ich nahm mir noch die rote Mappe vor. Außer dem letzten Schreiben vom Mai 1979, das nicht von L., sondern von einer »Ruth« unterschrieben war und Emma mitteilte, daß ihre Freundin gestorben sei, gab es nur noch einen Brief, in dem L. sich entschuldigt, daß die Abstände zwischen ihren Briefen so lang geworden seien.
»Glaub nicht, liebe Emma, daß ich nicht an Dich denke. Im Gegenteil, öfter als früher denke ich an unsere gemeinsamen Jahre, die ja auch meine ersten gemeinsamen Jahre mit meinem lieben Herrn gewesen sind. Du hast es erraten, Emma, warum ich so lange geschwiegen habe: Mein lieber Herr ist tot. Das einfach so hinzuschreiben fällt mir immernoch schwer. Die Sehnsucht nach ihm, nach seiner körperlichen Anwesenheit, läßt nicht nach. Immer noch erwarte ich, ihn in der Tür stehen zu sehen, wenn ich mich von meinem Schreibtisch umdrehe, immer noch empfinde ich den gleichen Schmerz, daß er nicht da ist, nie mehr da sein wird.
Er war verzweifelt. All seine Forschungen der letzten Jahre waren der Frage gewidmet: Wohin geht die Menschheit. Ich kann bezeugen, daß er nie lustvoll den Untergang unserer Spezies prophezeite. Die politischen Ereignisse der letzten Jahre, die McCarthy-Ära, der von den Amerikanern herbeigeführte Sturz Allendes in Chile und was danach in und mit diesem Land geschah, hat ihm den Rest gegeben. Es war ihm zur Gewißheit geworden, daß die Barbarei, der wir gerade noch hatten entfliehen können, sich unaufhaltsam über die Erde ausbreiten würde. Er ist freiwillig gegangen.
Ich bin alt geworden, das ist kein Vergnügen. Todesnähe ist kein Vergnügen. Ich arbeite noch, reduziert natürlich, weil ich diese Arbeit liebe, aber auch, weil man in diesem Land sonst schnell arm wird. Ich sehe Dora jetzt öfter, sie ist die tapfere Frau geblieben, die sie immer war, sie ordnet den Nachlaß ihres Mannes, ich helfe manchmal. Ich bin müde.«
Meine Freundin Emma konnte diesen Brief nicht mehr beantworten. Sie hat ihn sicher noch bekommen, da war sie schon im Krankenhaus. Sie litt an Schilddrüsenkrebs. Ich habe sie nie niedergeschlagen oder ängstlich gesehen. Durch eine List hat sie einer Schwester ihre Diagnose abgeluchst; sie hat sich dann auf ihren Tod vorbereitet, indem sie alles weggab, was sie nicht mehr brauchen würde, Papiere verbrannte. Einmal, als ich meine Trauer nicht verbergen konnte, sagte sie: Ach weißt du, ich hab alles erlebt, was ein Mensch in dieser Zeit erleben kann. Nun ist es auch genug.
Ich suchte Ablenkung. Ann, die Fotografin des CENTER,
Weitere Kostenlose Bücher