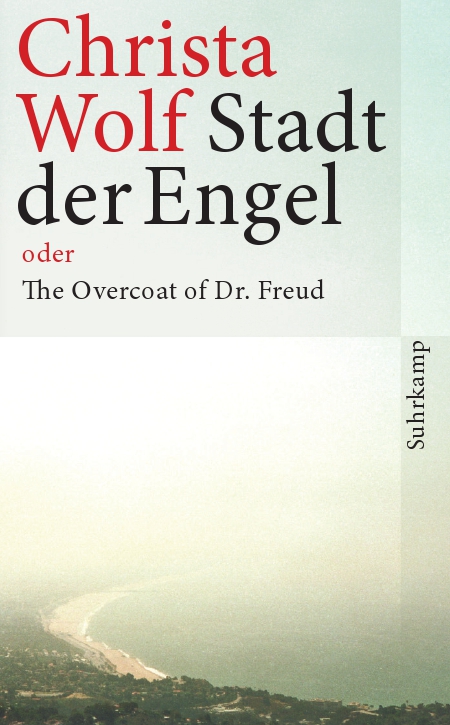![Stadt der Engel]()
Stadt der Engel
sagte Therese, und wir zogen uns eilig zurück.
Das war der unvergeßliche Tag, an dem Therese mich mit der Gang zusammenführte. An dem ich Jane kennenlernte, und Toby, und Margery. Die »Jungen« nannte ich sie und spürte, daß ich auf sie neugierig war. Noch nicht Susan, Susan war ein Gerücht, ein Gesprächsstoff unter ihnen. Susan gehörte dazu, und auch wieder nicht. Eigentlich hatte sie auch kommen wollen, aber keiner, der sie kannte, hatte wirklich mit ihr gerechnet. Sie hielt niemals eine Verabredung ein. Sie wolle sich interessant machen, indem sie die Verwirrte spiele, sagte Margery. Jane meinte, sie sei wirklich verwirrt, anders könne man sich ihre widersprüchlichen Aktionen doch nicht erklären. Wenn sie bezweckten, mich auf Susan neugierig zu machen, dann erreichten sie das.
Wir saßen in der gleißenden Sonne vor dem berühmten deutschen Café in der Main Street von Venice und aßen original deutschen Apfelkuchen, wir redeten miteinander, als würden wir uns lange kennen, anders als sonst in Amerika, dachteich, wo zwar auch gleich geredet wird, aber es blieben niceto-see-you-Gespräche, das hier war etwas anderes. Es tat mir wohl, daß sie miteinander umgingen, als sei ich nicht dabei, als störe ich sie nicht, und mir damit zeigten, ich störte sie wirklich nicht. Susan, erfuhr ich, war eine reiche Frau – nein, nicht wohlhabend, sagte Therese: wirklich reich. Sie besitze eine Insel. Nicht groß, aber immerhin. Zugleich sei sie etwas geizig, wie viele reiche Leute. Zum Beispiel wohne sie in einem winzigen Haus in einem der engen Sträßchen von Venice, das wie alle diese Häuser dem Verfall ausgeliefert sei. Aber teuer! rief Margery. Macht euch da bloß nichts vor! Übrigens sei Susan gerade dabei, eine Villa in Beverly Hills zu kaufen, sie feilsche mit dem Makler, schließlich werde sie sich das Objekt noch durch die Lappen gehen lassen. Alle lachten. Ich erfuhr, daß die modernen Häuser, die eine Seite des kleinen Platzes bildeten, auch Susan gehörten, daß Jane dort ihre Fotogalerie aufmachen konnte. Ob ich sie sehen wolle? Gewiß.
Ich erfuhr, Jane war selbst Fotografin, eine ausgezeichnete, flüsterte Margery mir zu. Sie wiederum therapierte Ehepaare, die nicht miteinander zurechtkamen, erklärte sie schulterzuckend. Mit irgendwas müsse man ja sein Geld verdienen. Manchmal habe sie diese reichen Leute gründlich satt, die sich vor lauter Langeweile gegenseitig das Leben schwermachten. Und Toby? Ein schmaler, stiller jüngerer Mann, ich hatte den Eindruck, niemand wollte ihm zu nahe treten. Ich sah, wie er eine Hand flüchtig auf Thereses Schulter legte und sie ihre Wange an seiner Hand rieb, während wir zu Janes Atelier hinübergingen. Eine sehr begabte junge ungarische Fotografin hatte Jane aufgetrieben, Landschaften, Gesichter, wie ich sie noch nicht gesehen hatte. Jane liebte diese Arbeiten, sie war stolz auf sie wie auf eigene. Ich fühlte mich immer stärker zu ihr hingezogen, aber hatte ich denn noch Zeit, hier neue Freundschaften anzufangen? Da verabredete Therese schon unser nächstes Treffen.
Ruth rief an. Sie müsse mich unbedingt sehen. Sie müsse mit mir über den Abend bei der »second generation« sprechen, anden sie immerzu denken müsse. Sie war nicht zufrieden mit den Teilnehmern. Die würden sich in ihren Kummer und in ihre Vorurteile gegenüber Deutschland einspinnen. Sie würden sich keine Mühe geben, die neue Realität wahrzunehmen. Sie würden es strikt ablehnen, deutschen Boden zu betreten. Sie hätten die größten Schwierigkeiten mit ihren Eltern, manche von ihnen seien weit von den Eltern weggezogen, nur, um sie nicht zu oft sehen zu müssen. Aber die Meinung der Eltern zu den Deutschen hätten sie kritiklos übernommen.
Das ist doch verständlich, sagte ich.
Ja und nein, sagte Ruth. Die andere Seite der Medaille sei es ja, daß sie sich danach sehnten, mit Deutschen über die Wunde zu sprechen, die die ihnen beigebracht hätten. Das hätte ich wohl gemerkt. Danach sei sie von mehreren angerufen worden: Endlich hätten sie einmal mit einer Deutschen sprechen können, die glaubwürdig gewesen sei.
Mehr kann man doch nicht verlangen, sagte ich.
Meine Mutter ist schwer krank, sagte Ruth. Sie wird sterben.
Mein Herz begann laut zu klopfen: Die Mutter würde sterben, ohne daß die Tochter sich mit ihr versöhnt hatte. Ruth hatte meine Gedanken erraten. Nein, sagte sie. Sie hätten sich ausgesprochen. Sie hätten zueinander gefunden. Es sei nicht die Spur von
Weitere Kostenlose Bücher