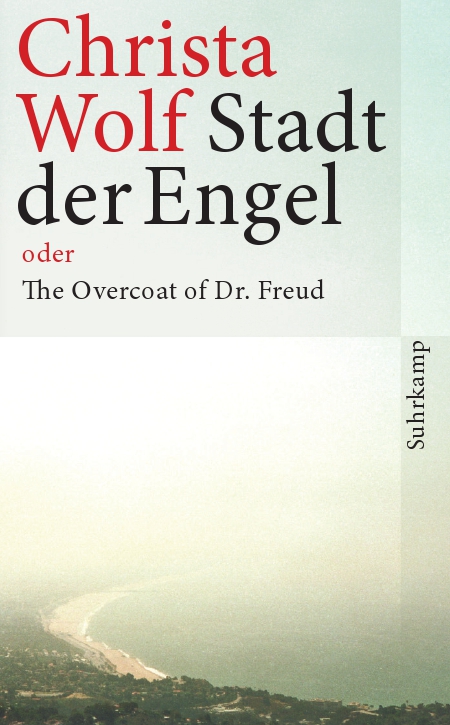![Stadt der Engel]()
Stadt der Engel
große Platte, Ines tat den Salat in Schüsselchen, wir alle hatten in unseren Küchenschränken das gleiche weiße Geschirr. DerWeißwein war gut gekühlt, wir hatten Hunger, es schmeckte, wir waren in Stimmung.
Übrigens, fragte Pintus, hätten wir nicht bemerkt, daß die Nation viel stärker als vom Ausgang der Wahlen bewegt sei vom endgültigen Rücktritt ihres Idols, des Basketballspielers »Magic Johnson«, der leider HIV-infiziert sei und nach seiner kurzen umjubelten Rückkehr in seine Mannschaft nun wegen Bedenken von Spielern aus anderen Mannschaften das Handtuch werfen mußte, Spieler, die das Risiko nicht eingehen wollten, daß sowohl er als auch einer von ihnen verletzt werden und ihr gesundes Blut sich mit seinem kranken vermischen könnte. Dieser Vorgang spalte die Nation, nicht die einander so ähnlichen Programme der Präsidentschaftskandidaten.
Wir schwiegen.
Ich versuche mich in jene vergangene Zeit zurückzudenken, die jetzt wie ein gut beleuchtetes, durchschaubares Gelände vor uns, eigentlich hinter uns liegt, und ich frage mich, ob wir, bei aller Skepsis, damals schon so deutlich und unbezweifelbar voraussahen, wie es heute sein würde. Daß wir wieder im Krieg sein würden. Nur Peter Gutman hielt wohl alles für möglich, es war nach jenem Risotto-Abend bei Francesco und Ines, daß er mich mit hinaufnahm in sein Apartment, zum ersten Mal übrigens, er sagte, für ihn sei der Tag noch nicht zu Ende. Darauf mußte ich sagen: Für mich auch nicht, und mußte hinter ihm ein Stockwerk höher hinaufsteigen in die Wohnung, die genauso geschnitten war wie die meine, und die von meiner so verschieden war, wie man es sich nicht ausdenken konnte. Ich kam in eine unberührte Behausung, in der nichts darauf hinwies, daß hier jemand wohnte. Kein Buch, kein Bild, keine Zeitung auf dem Tisch, keine Blume, nicht mal ein Stuhl war verrückt, beklemmende Nüchternheit. Peter Gutman sah mich in der Tür stehen, er wußte, daß der Anblick seiner Wohnung mich schockierte, er sagte nichts, ich sagte nichts. Er wies mir den bequemen Sessel an, er ging in die Küche, ich hörte die Kühlschranktür auf- und zuschnappen, er brachte guten Weißwein,davon verstand er etwas. Irgendwann sagte er, daß Gemütlichkeit ihn anekele, wegen ihrer Verlogenheit. Er hatte, glaube ich, an diesem Abend ein Ziel, er wollte etwas bei mir erreichen. Es fing damit an, daß er mich provozierte: Die haben euch den Schneid abgekauft, sagte er.
Ich verstand, was er meinte, aber ich stellte mich dumm. Wer? Wem? Welchen Schneid?
Darauf ging er gar nicht ein. Verlierer ist man erst, wenn man sich selbst als Verlierer sieht, sagte er.
Objektive Kriterien lasse er also nicht gelten?
Es gehe darum, ob man sich von der anderen Seite, der Gewinnerseite, definieren lasse.
Kurz und gut, Peter Gutman hatte sich vorgenommen, mich gegen so etwas wie Selbstaufgabe abzuschirmen. Er habe nämlich, erklärte er mir viel später, eine Art untergründige Depression an mir beobachtet, gegen die wollte er angehen. Allerdings konnte er zu diesem Zeitpunkt ihren wahren Grund noch nicht ahnen.
Es muß an demselben Abend gewesen sein, daß ich Peter Gutman von einem lange zurückliegenden Theatererlebnis erzählte. Es muß in den fünfziger Jahren gewesen sein, sagte ich. »Ljubow Jarowaja« – das Stück eines sowjetischen Autors. Die Titelheldin kämpft 1919 im Bürgerkrieg als Offizierin auf seiten der Roten. Ihr Mann, den sie liebt, ist weißer Offizier, plant einen Anschlag auf die Roten und läßt sich von Ljubow in einer zerstörerischen Auseinandersetzung nicht davon abbringen. Also erschießt sie ihn. Muß sie ihn erschießen, suggeriert der Stückeschreiber. Und ich dachte, erzählte ich Peter Gutman: So muß eine Revolutionärin sein. Dazu muß sie fähig sein. Und zugleich wußte ich: So könnte ich nie werden.
Und? fragte er.
Und ich brauchte lange, bis ich erkannte, daß eine Moral, die Menschen in solche Konflikte stellt, ihnen etwas von ihrem Menschsein nimmt. Der neue Mensch als der reduzierte Mensch.
Geschieht aber überall, wo bis aufs Messer um Ideen gekämpft wird, bis heute, sagte Peter Gutman. Gerade heute.
Es sei wohl nicht leicht, so etwas aufzuschreiben, sagte er dann.
Nein.
Mach es trotzdem. Kannst es ja später rausnehmen.
Mir fällt ein, daß wir uns nie beim Vornamen nannten. »Monsieur«, »mein Herr« reichten mir aus, ihn anzureden. Er nannte mich »Madame« oder vermied die Anrede.
Adieu, Monsieur.
Schlafen Sie
Weitere Kostenlose Bücher