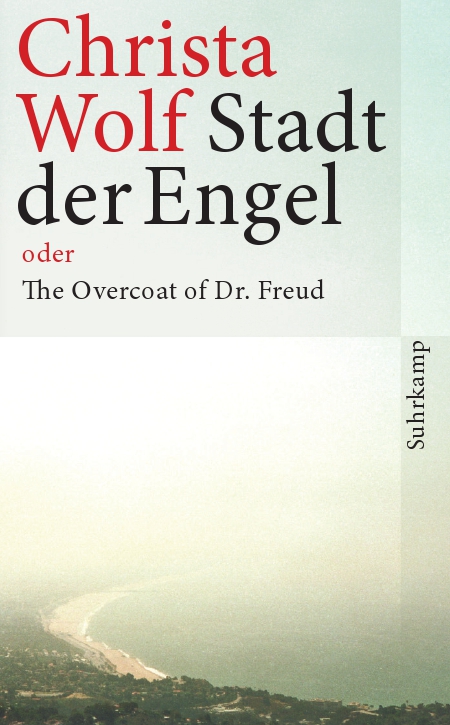![Stadt der Engel]()
Stadt der Engel
das ich niemals benutzte, aber da war nicht mit ihnen zu reden – und die jetzt in der Küche saubermachten. Diese Hitze,sagte ich, und ob sie nicht Durst hätten, zögernd gaben sie es zu, wollten aber nicht, daß ich ihnen etwas zu trinken anbot, ich mixte für uns drei einen Campari Soda, zögernd nahmen sie ihn, nur Alfonso setzte sich zu mir an den kleinen runden Küchentisch und trank schnell, Angelina wollte sich nicht setzen, sie sei so müde, sagte sie, daß sie nicht wieder hochkäme, wenn sie sich erstmal hingesetzt hätte. Mein Verdacht blieb, daß sie sich in meiner Gegenwart nicht hinsetzen wollte. Angelina war nicht nur dunkelbraun, wie die meisten, die von uns Weißen »schwarz« genannt werden, Angelina war wirklich schwarz. Sie hatte Rundungen, wo immer eine Frau Rundungen haben kann, ohne dick zu sein, auch ihre Stirn, ihre Wangen, ihre Lippen waren gewölbt, selbst ihr Kinn war rund, auch die Flügel der Nase, deren Sattel tief zwischen die halbkugeligen Wölbungen der weiß blitzenden Augen eingelassen war, waren abgerundet, die Ellenbogen, die Knie, die unter dem weiten bunten Rock hervorkamen, wenn sie sich reckte, und ihr Haar lag in kleinen runden Locken auf ihrem kugelrunden Kopf. Wie lange sie hier sei, fragte ich sie. Sechs Jahre. Sie komme aus Uganda. Dort habe sie sechs Kinder, die zuerst bei ihrer Mutter, nach deren Tod bei ihrer Schwester lebten und für die sie hier arbeite, I have to work very hard, sagte sie lächelnd, und ich erfuhr, daß sie manchmal zwei Schichten am Tag machte, in verschiedenen Hotels, und kaum zum Schlafen kam. Nach dem Vater der Kinder fragte ich nicht, ich fragte Angelina, wie alt sie sei, sechsunddreißig, sagte sie, und ihre Kinder seien zwischen sechs und achtzehn, seit 1989 habe sie sie nicht gesehen, drei Jahre, der Flug sei so teuer. Sie gab mir zum Abschied die Hand und bedankte sich für den Drink mit einem Knicks.
An diesem Vormittag war ich froh, daß sie bald mein Apartment verließen, Angelina und Alfonso, und daß ich im großen Zimmer nach der roten Mappe im Regal greifen konnte. Ich hatte mich nicht getäuscht, einer von L.s Briefen war im Winter 1977 geschrieben, und er war eine Erwiderung auf einen Brief von Emma, in dem sie offensichtlich etwas von den jüngstenEreignissen in unserem Land angedeutet haben mußte. Mir war klar, daß große Teile des Briefwechsels nicht den offiziellen Postweg gegangen waren, und ich hatte wenig Hoffnung, nachträglich herauszufinden, welch unverdächtige Boten sich Emma und L. bedient hatten.
L. hatte also im Februar 1977, in jenem düsteren Winter, an ihre (und meine!) Freundin Emma geschrieben:
»Meine Liebe, nein, ich glaube nicht, daß die Geschichte sich wiederholt. Mein lieber Herr ist zwar der Meinung, wir Menschen, besonders wir linken Menschen, seien nicht fähig, aus Fehlern zu lernen. Aber sieh doch mal: Du und ich, wir können doch ohne falsche Bescheidenheit sagen: Wir haben was gelernt. Du warst nicht mehr wie früher im Stande, den Dogmen zuzustimmen, die in jedem Andersdenkenden den Klassenfeind sehen, und hast nicht zu knapp dafür bezahlt. Und ich, die ich dich damals für Deine Parteitreue mit Hohn und Spott überzog, ich kann heute verstehen, daß Du diese Partei nie verlassen hast. Heute würden wir uns nicht mehr um solche Fragen streiten, uns zornbebend in deiner Küche gegenüberstehen. Ist das vielleicht kein Fortschritt?
Ich sehe sie übrigens vor mir, Deine Küche, jedes einzelne Stück könnte ich beschreiben. Ja, manchmal bin ich traurig, daß ich die Küche, in der Du jetzt mit Deinen Freunden hockst, nie sehen werde. Auch dieses Mädchen nicht, das Dir Sorgen zu machen scheint. Sie läuft in jedes Messer? Warum wohl. Was will sie sich damit beweisen? Daß sie mutig ist? Daß sie was bewirken kann? Oder einfach nur, daß die Sache, an die sie glauben will, jeden Einsatz lohnt.«
Hatte meine Freundin Emma diese Fragen eigentlich an mich weitergegeben? Manchmal rührte es mich, manchmal verletzte es mich, daß die beiden hinter meinem Rücken über mich geredet hatten. Wenn es stimmte, daß ich in jedes Messer gelaufen war, dachte ich, dann doch nur, weil ich das Messer nicht fürein Messer hielt. Das änderte sich. Warum so langsam? So mühevoll?
L. schrieb: »Laß doch den Jungen ihre eigenen Erfahrungen. Sie werden es nicht schlechter machen als Du und ich, wenn sie was taugen. Aber was sollen sie tun? Klein beigeben?«
Perma, die buddhistische Nonne, erzählte die
Weitere Kostenlose Bücher