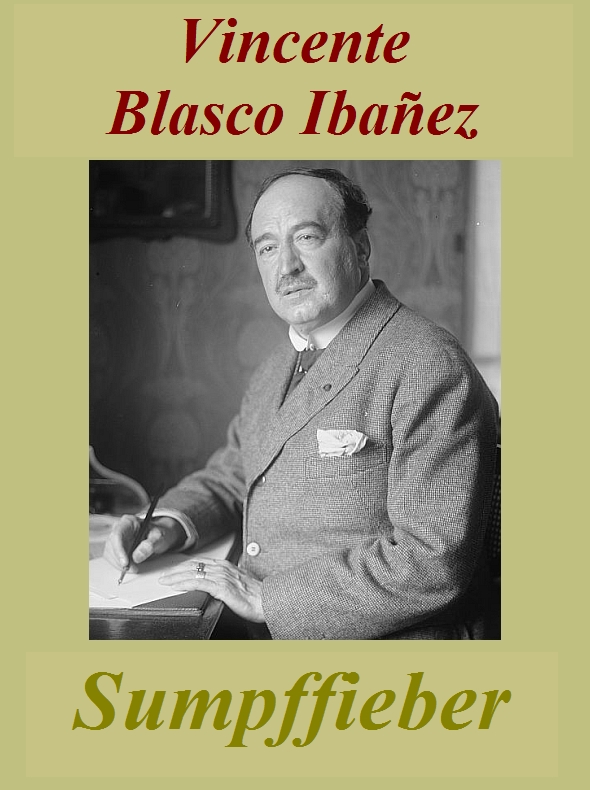![Sumpffieber]()
Sumpffieber
Gefahr ins Auge sehen! Harrte sie auf ihrem Platz aus, so durfte sie hoffen, weniger beobachtet zu werden. Doch mit Entsetzen dachte sie an die Entbindung, dieses schmerzhafte Mysterium, das ihr, weil es für sie in das Dunkel des Unbekannten gehüllt war, noch grausiger erschien. Diese Angst suchte sie zu vergessen, indem sie so viel Zeitwie eben möglich den Erntearbeiten widmete, mit den Schnittern wegen des Taglohns feilschte und Tonet schalt, der in ihrem Auftrage die Arbeiter überwachte, aber in seinem Boot stets Cañamels Flinte sowie die treue Centella mitnahm und sich mehr damit beschäftigte, Federwild zu schießen, als die Reisgarben zu zählen.
Bisweilen räumte sie den Platz am Schanktisch ihrer Tante ein und wanderte zur Tenne, einer Plattform von hartgestampftem Lehm, die sich inmitten des ihre Felder umspülenden Wassers erhob. Diese Ausflüge brachten ihrer Pein ein wenig Linderung.
Hinter Garbenbündeln verborgen, riß sie ihr Korsett auf und setzte sich neben Tonet auf den riesigen Haufen von Reisstroh. Zu ihren Füßen gingen die Pferde rundum bei der monotonen Drescharbeit, vor ihnen dehnte sich die ungeheure grüne Metallplatte der Albufera, in der sich die roten und bläulichen Berge des Horizonts umgekehrt widerspiegelten.
Hier fühlten sich die beiden glücklicher als in dem verschlossenen Schlafzimmer, dessen Dunkel sich mit Schreckgespenstern bevölkerte. Die Wasser des Sees lächelten süß, während er die jährliche Ernte hergab, die sein Schoß getragen hatte; die Lieder der Schnitter und der Mannschaften in den großen, mit Reis beladenen Barken schienen die Mutter Albufera zärtlich einzuwiegen nach dieser Geburt, die das Leben ihrer Söhne sicherte.
Die heitere Ruhe besänftigte auch Neletas erregten Charakter. An den Fingern zählte sie die Monate ab und rechnete den Zeitpunkt ihrer Entbindung aus. Schon sehr bald mußte das peinliche Ereignis eintreten, das ihr Schicksal ändern konnte – im kommenden Monat, im November ... vielleicht gerade dann, wenn auf dem See die großen Jagden von San Martin stattfanden. Bei dieser Berechnung erinnerte sie sich, daß noch kein Jahr seit Cañamels Tod verstrichen war, und in ihrer unbewußten Perversität, begierig, Genuß und Leben in Übereinstimmung zu bringen, bedauerte sie, daß sie sich Tonet nicht bereits Monate früher hingegeben habe. Ohne Bedenken hätte sie ihre Schwangerschaft zeigen können, indem sie die Vaterschaft des Kindes dem Ehemann zuschob.
Eine schwache Hoffnung keimte auf.
»Tonet ... wer weiß, ob das Kind, nachdem ich so viel Schreckliches erlitten habe, nicht tot zur Welt kommt? Es wäre nicht das erstemal, daß so etwas geschieht.«
Und das Paar, eingelullt in diese Illusion, sprach von dem totgeborenen Kindwie von etwas absolut Sicherem, Unvermeidlichem, während Neleta die Bewegungen in ihrem Leibe belauschte, ganz glücklich, wenn das kleine, dort verborgene Wesen kein Lebenszeichen gab.
»Kein Zweifel, Tonet! Es wird sterben! Das Glück, das mir stets zur Seite stand, wird mich nicht im Stich lassen.«
Das Ende der Ernte lenkte sie von diesen Gedankengängen ab. Die vollen Säcke türmten sich in der Taverne. Der Reis füllte alle Zimmer, häufte sich neben dem Schanktisch, wo er den Gästen den Platz streitig machte, ja, nahm sogar die Ecken von Neletas Schlafzimmer für sich in Anspruch. Sie war begeistert über den Reichtum, den die Säcke einschlossen, war trunken vor Freude über den scharfen Geruch des Reisstaubes, den ihre Nase wollüstig einsog. Und die Hälfte von diesem Schatz hätte der Samaruca gehören können! ... Der Gedanke allein genügte, um Neleta ihre ganze Stärke zurückzugeben.
»Dieses Verheimlichen ist eine unerhörte Marter, aber eher sterben als mich plündern lassen!«
Es tat not, solche energischen Entschlüsse zu fassen. Ihr Zustand verschlimmerte sich; die Füße schwollen an. Sie hatte den unwiderstehlichen Wunsch, sich nicht zu rühren, im Bett zu bleiben – und nichtsdestoweniger stieg sie jeden Tag die Treppe hinunter zu ihrem Platz am Schanktisch, denn der Vorwand einer Krankheit konnte dem Argwohn ihrer Feinde neue Nahrung geben. Ihre Bewegungen waren langsam, wenn sie eine Bestellung ihrer Gäste zum Aufstehen nötigte, und ihr gezwungenes Lächeln war nichts als eine schmerzliche Verzerrung, die Tonet frösteln ließ. Die Taille, wie in einen Schraubstock eingezwängt, schien den starken Fischbeinpanzer sprengen zu wollen.
»Ich kann nicht mehr!« ächzte sie
Weitere Kostenlose Bücher