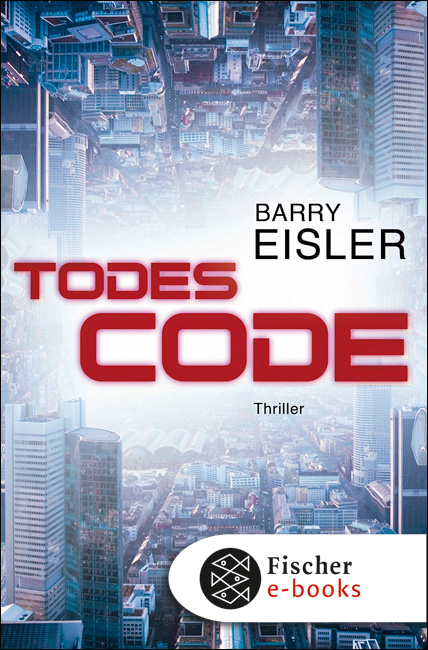![Todescode]()
Todescode
vergessen, kaum dass sie ihr Examen und die Zulassung in der Tasche hatte. Sie wusste daher nicht, wie schlimm es juristisch für sie aussah. Und die juristische Seite war vielleicht sogar das geringste Problem.
Sie wusste, dass Ben ihr nicht traute. Und die Art, wie er sie ansah, wie er beiläufig herübergeschlendert war, um einen Blick auf ihren Laptopbildschirm zu werfen … Fürchtete er, dass sie die Nerven verlieren, zur Polizei gehen würde? Und was würde er machen, falls ja?
Sie hatte zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Sie konnte den Mund halten in der Hoffnung, dass schon irgendwie alles gutgehen würde. Oder sie könnte das Problem direkt in Angriff nehmen.
Sie verließ das Hotel und ging die Stockton Street hoch. Es war ein kalter klarer Abend, und der Mond hing als dünne Sichel tief am Himmel. In Chinatown war es angenehm ruhig, die meisten Läden hatten inzwischen geschlossen, verschanzt hinter Wellblechjalousien. In manche Jalousien waren Türen eingelassen, von denen einige offen standen. Durch sie hindurch sah sie Familien beim Abendessen und Freunde beim Kartenspielen, roch den Duft von gegartem Reis und süßem Gebäck und hörte Lachen und Gespräche in einer melodischen Sprache, die sie gern verstehen würde. Hinter der einen oder anderen Tür waren steile, schmale Treppen zu sehen, die aus ihrem Blickwinkel nach oben verschwanden. Sarah fragte sich, in was für Zimmer sie führen mochten, wer sie wohl morgens und abends benutzte, welche Leben in den verborgenen Räumen dort oben geführt wurden.
Sie kam an einem Wandbild vorbei, einer Hommage an die chinesischen Eisenbahner. Davor standen Lampions, die in der Brise flackerten und zitterten. Sie bog nach rechts in die Pacific Avenue, sah zu den alten Holzgebäuden hinauf, ihren grün-rot gestrichenen Balkonen, den im asiatischen Stil nach oben gebogenen Traufen. Im Erdgeschoss eines der Häuser schloss ein alter Mann gerade sein Geschäft, einen Kräuterladen, in dessen Auslagen Glasgefäße mit schauerlichem Getier standen, das von der Erde oder aus dem Meer oder ganz woanders hergekommen sein mochte. Er winkte und lächelte ihr zahnlos zu, als sie vorbeiging, und sie nickte und lächelte ebenfalls.
Als sie auf die Columbus traf, setzten der Verkehr und das Neonlicht von North Beach der Stille des verschlafenen Chinatown ein jähes Ende. Da war es, das Jazz at Pearl’s, ein Club mit Fenstern, die nach vorne rausgingen, und einem Eingang unter einer roten Markise. Sie überquerte die Straße und ging hinein, nachdem sie dem Türsteher erklärt hatte, dass sie zwar keine Karte reserviert habe, aber mit einem Freund verabredet sei. Sie wollte nur kurz nach ihm schauen.
Es war ein kleines Lokal mit vielleicht dreißig Gästen, weichem Teppichboden, rötlicher Beleuchtung und kleinen runden Tischen mit weißen Leinentüchern. Eine üppige Schwarze sang »Need My Sugar« zu Klavier- und Bassbegleitung, und das Publikum wippte mit den Füßen im Takt. Ben war nicht da. Vielleicht war er zu den Toiletten gegangen? Sie wartete fünf Minuten und gab es dann auf, überrascht, wie enttäuscht sie war. Wenn sie ihn nicht zur Rede stellte, wenn sie die Sache nicht hinter sich brachte, wusste sie nicht, wie sie heute Nacht schlafen sollte.
Sie war gerade nach links die Columbus hochgegangen und überlegte, vielleicht im Café Prague noch etwas zu essen, ehe sie sich bei Walgreens oder irgendeinem anderen Laden, der noch geöffnet hatte, mit Unterwäsche und ein paar anderen Dingen eindeckte, als jemand ihren Namen rief. Sarah schaute sich um, entdeckte aber niemanden. Ein Bus fuhr vorbei. Hatte sie sich das eingebildet? Und dann hörte sie es wieder. Sie blickte hoch und sah Ben am Fenster im ersten Stock vom Vesuvio. »Kommen Sie rauf«, rief er.
Sie spürte einen seltsamen Anflug von Freude, die sie nicht genau benennen konnte – Aufregung? Erleichterung? –, und überquerte die Straße.
Sie ging hinein, und das Lokal gefiel ihr auf Anhieb. Es war schon irgendwie komisch, dass sie in San Francisco lebte, ohne je im Vesuvio gewesen zu sein. Aber sie war ja auch noch nie rüber nach Alcatraz gefahren. Das Vesuvio war eine von diesen Touristenattraktionen, bei denen man davon ausging, dass es sie immer geben würde und dass man schon irgendwann mal hinkäme. Womit sie es nicht sonderlich eilig gehabt hatte. In ihrer Vorstellung war das Vesuvio eher eine Art Beatnik-Museum als eine richtige Bar, in die man ging, um was zu trinken. Doch die
Weitere Kostenlose Bücher