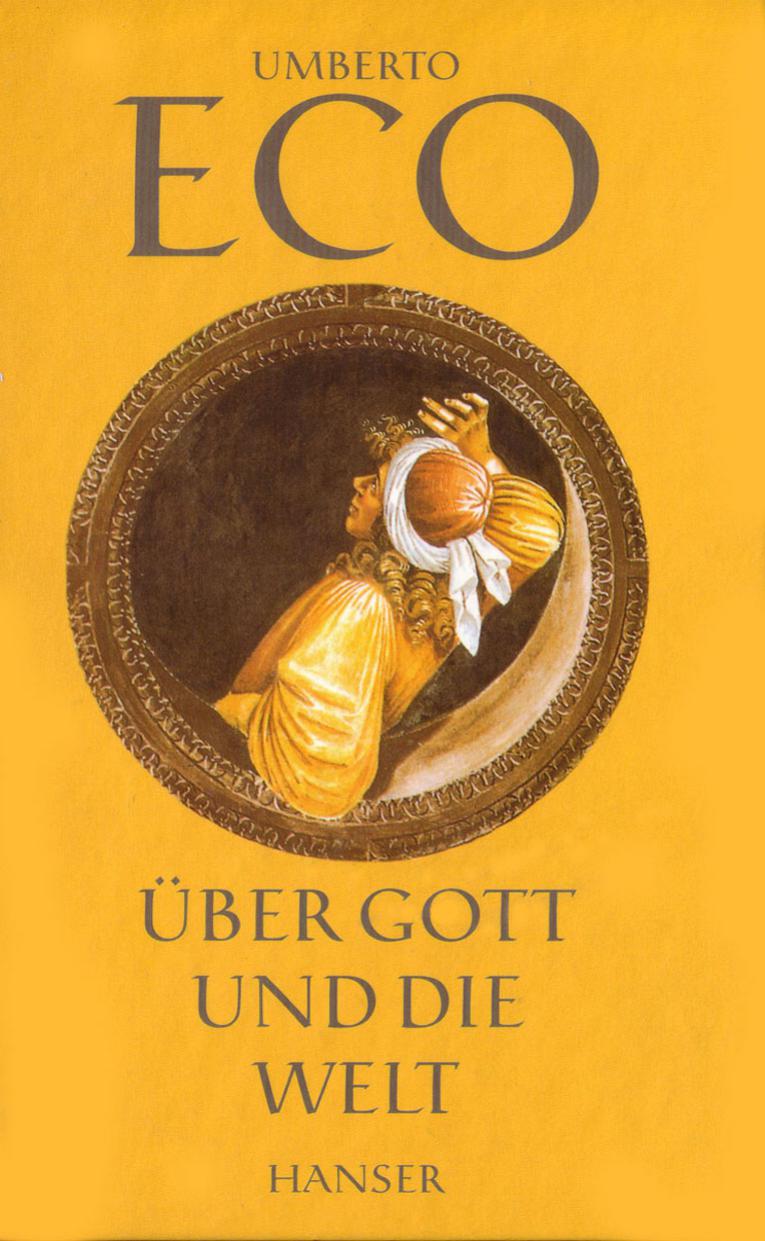![Über Gott und die Welt]()
Über Gott und die Welt
mit einem meiner Freunde, der bloß ein Filho de Xangò ist.
Zwei Tage später, in Rio, führen mich andere Freunde zu einem anderen Terreiro de Candomblé. Die Gegend ist noch ärmer, der Volksglaube noch naiver, und wenn der Tempel in São Paulo wie eine protestantische Kirche erschien, gleicht dieser hier einem mediterranen Wallfahrtsort. Die Kostüme sind afrikanischer, die von Oxalà besuchten Glücklichen bekommen am Ende
prächtige Masken, wie ich sie bisher nur in den Alben von Cino und Franco gesehen habe: große Gebilde aus Stroh, die den ganzen Körper bedecken. Sie reihen sich zu einer Prozession von Pfl anzengeistern, von den Feiernden an der Hand geführt wie Blinde, blind umhertappend in ihren katatonischen Zuckungen nach dem Diktat des Gottes.
Die Comida dos santos, das rituelle Mahl, das den Orixà dargebracht wird, ist beste bahianische Küche, die Speisen werden im Freien auf großen Blättern ausgebreitet, sozusagen enorme Präsentkörbe voller Stammesspezialitäten, und am Ende des Ritus dürfen auch wir davon kosten. Der Pai-de-santo ist ein kurioser Typ, gekleidet wie Orson Welles als Cagliostro, das junge Gesicht von einer etwas weichen Schönheit (er ist ein blonder Weißer), priesterlich-gütig lächelnd, wenn seine Gläubigen ihm die Hände küssen. Mit knappen Bewegungen, eine Art John Travolta der Vorstadt, dirigiert er die verschiedenen Phasen des Tanzes, später legt er die Paramente ab und erscheint in Jeans, um die Trommler zu einem schärferen Rhythmus anzutreiben, einem Tempo, das sich mehr auf diejenigen unter den Tanzenden einstellt, die gerade in Trance zu fallen beginnen. Er läßt uns nur zu Beginn und am Ende zuschauen, offenbar will er nicht, daß wir dabei sind, wenn die Initiierten in Trance fallen, was immer der heikelste Augenblick ist. Aus Rücksicht auf uns oder auf seine Gläubigen?
Anschließend führt er uns in seine Wohnung und offeriert uns ein Essen auf der Grundlage von Fejoada.
An den Wänden hängen eigenartige grellbunte Bilder, halb indianisch und halb chinesisch, surreale Figuren, wie man sie in amerikanischen Underground-Magazinen »orientalisierender«
Gruppen sieht. Sie stammen von ihm, er malt. Wir plaudern über Ethik und Theologie. Er hat nichts von der theologischen Strenge des Pai-de-santo in São Paulo, seine Religiosität ist nach-sichtiger, pragmatischer. Er meint, es gebe kein Gut und Böse, alles sei gut. Ich deute auf einen Freund und sage: »Aber wenn der mich nun umbringen will und zu Ihnen kommt, um sich einen Rat zu holen, dann müssen Sie ihm doch sagen, daß es böse ist, mich zu töten!« »Ich weiß nicht«, antwortet er mit einem vagen Lächeln, »vielleicht ist es für ihn etwas Gutes, ich weiß nicht, ich würde ihm nur erklären, daß es besser wäre, Sie nicht zu töten.
Aber seien Sie unbesorgt, er wird Sie nicht töten, wenn er zu mir kommt.« Wir probieren noch ein paar Argumentationen über Gut und Böse. Er bleibt dabei: »Seien Sie ganz beruhigt, ich sorge dafür, er wird Sie nicht töten.« Er zeigt einen sanften Stolz auf sein Charisma. Er spricht von der Liebe, die er zu seinen Leuten empfi ndet, von der ruhigen Heiterkeit, die aus dem Kontakt mit den Orixà erwächst. Er äußert sich nicht über ihre kosmische Natur, auch nicht über ihr Verhältnis zu den Heiligen. Da gebe es keine Unterschiede, es genüge, heiter zu sein. Der Candomblé wechselt die Theologie von Terreiro zu Terreiro. Ich frage ihn, welcher Orixà der meinige ist. Erneut weicht er aus, das sei schwer zu sagen, das könne je nach den Umständen wechseln, er glaube nicht an die Möglichkeit, das zu beurteilen. Aber wenn ich’s unbedingt wissen wolle, nun ja, so wie ich aussähe, müßte ich wohl ein Sohn von Oxalà sein. Ich sage ihm nicht, daß ich dasselbe schon vor zwei Tagen gehört habe. Ich möchte ihn immer noch gern ertappen.
Mein Freund, der mich hätte umbringen sollen, spielt jetzt den engagierten Brasilianer. Er hält ihm die Widersprüche des Landes vor, die sozialen Ungerechtigkeiten, er fragt ihn, ob seine Religion die Menschen auch zur Revolte antreiben könnte. Der Babalorixà weicht aus, das seien Probleme, zu denen er sich nicht äußern wolle, dann lächelt er wieder übertrieben sanft wie vorhin, als er mir versicherte, daß ich bestimmt nicht umgebracht werden würde, und murmelt etwas wie: »Aber wenn es nötig wäre, könnte man …«
Was hat er sagen wollen? Daß es vorerst nicht nötig sei? Daß der Candomblé immerhin
Weitere Kostenlose Bücher