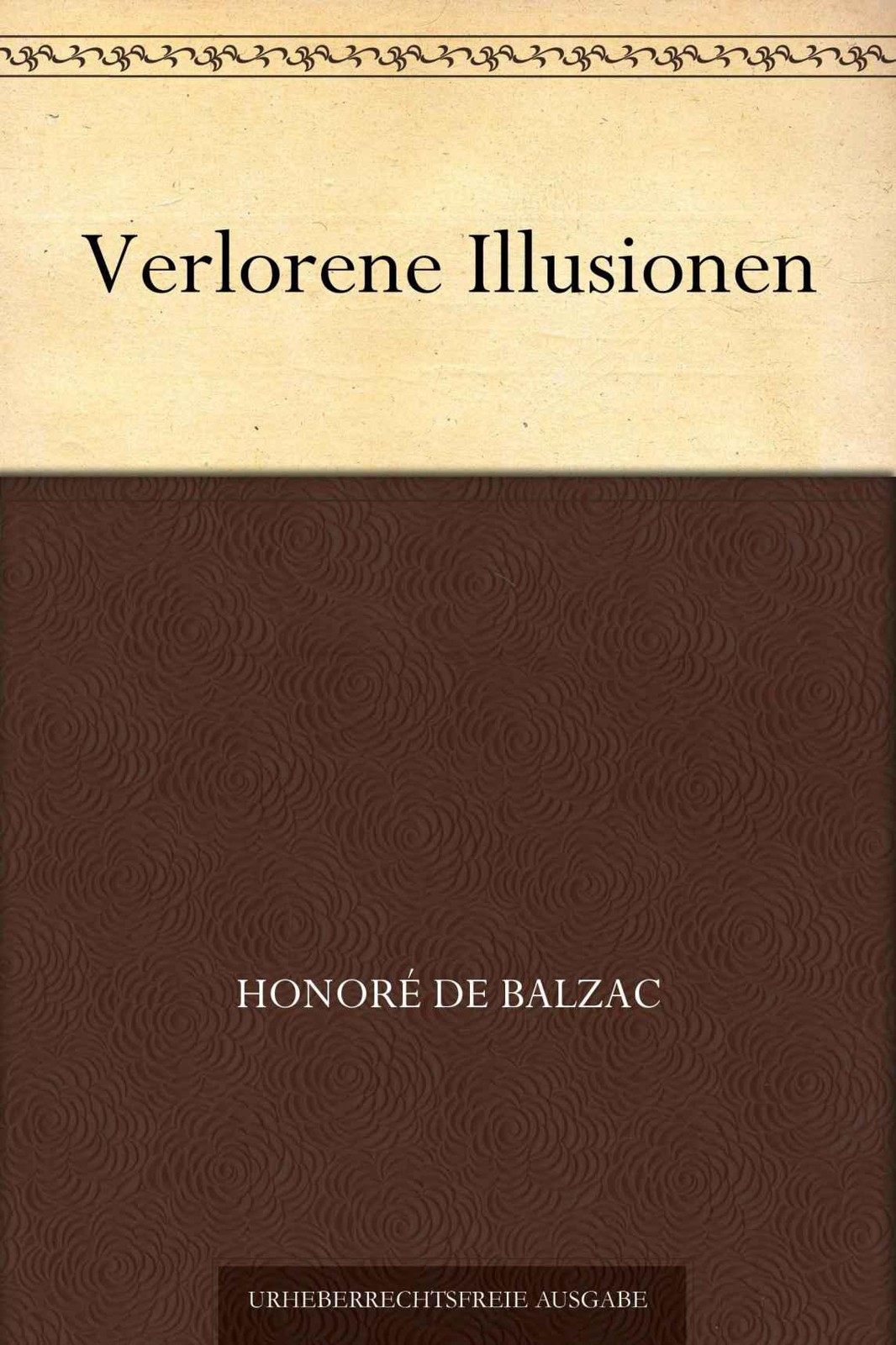![Verlorene Illusionen (German Edition)]()
Verlorene Illusionen (German Edition)
er Lucien auf eine Art an, die zeigen sollte, daß es sich um einen großmütigen Vorschlag handelte.
»Für den Band?« fragte Lucien.
»Für den ganzen Roman«, erwiderte Doguereau, ohne sich über die Überraschung Luciens zu wundern. »Aber«, fügte er hinzu, »in barem Geld. Sie verpflichten sich, mir sechs Jahre lang zwei solche zu liefern. Wenn der erste in einem halben Jahr vergriffen ist, zahle ich Ihnen für die folgenden sechshundert Franken. So bekommen Sie also, zwei im Jahr gerechnet, hundert Franken im Monat, haben ein gesichertes Leben und sind glücklich. Ich habe Autoren, denen ich nur dreihundert Franken für den Roman zahle. Für eine Übersetzung aus dem Englischen gebe ich zweihundert Franken. In früheren Zeiten wäre das ein unerhörter Preis gewesen.«
»Werter Herr, wir können uns nicht verständigen; bitte, geben Sie mir mein Manuskript wieder«, sagte Lucien wie zu Eis erstarrt.
»Bitte, hier!« erwiderte der alte Verleger. »Sie verstehen nichts vom Geschäft, lieber Herr. Ein Verleger, der den ersten Roman eines Autors herausgibt, riskiert sechzehnhundert Franken für Druck und Papier. Es ist leichter, einen Roman zu schreiben, als eine solche Summe zu finden. Ich habe hundert Romanmanuskripte zu Hause, aber ich habe keine hundertsechzigtausend Franken in der Kasse. O weh! so eine Summe habe ich in den zwanzig Jahren, seit ich Buchhändler bin, nicht verdient. Man erwirbt kein Vermögen, wenn man Romane druckt. Vidal & Porchon nehmen sie uns nur zu Bedingungen ab, die von Tag zu Tag drückender für uns werden. Sie riskieren Ihre Zeit, aber ich muß zweitausend Franken daranwagen. Wenn es kein Geschäft wird – denn Sie wissen ja, habent sua fata libelli –, verliere ich zweitausend Franken; Sie aber brauchen nichts weiter zu tun, als eine Ode gegen die Dummheit des Publikums herauszugeben. Denken Sie über das nach, was ich die Ehre habe, Ihnen zu sagen. Sie werden dann wieder zu mir kommen. – Sie kommen wieder!« wiederholte der Buchhändler nachdrücklich und beantwortete damit eine hochmütige Handbewegung, die Lucien nicht hatte zurückhalten können. »Sie werden nicht nur keinen Verleger finden, der zweitausend Franken für einen unbekannten jungen Menschen riskieren will, Sie finden nicht einmal einen Gehilfen, der sich die Mühe nimmt, Ihr Gekritzel zu lesen. Ich habe es gelesen und kann Ihnen mehrere Sprachschnitzer nachweisen. Sie haben ›bemerken‹ gesagt, wo es heißen müßte: ›eine Bemerkung machen‹, und haben ›trotz‹ mit dem Genitiv geschrieben: ›trotz‹ regiert den Dativ.« Lucien schien sehr geknickt. »Wenn ich Sie wiedersehe, haben Sie hundert Franken verloren,« fügte Doguereau hinzu, »ich gebe Ihnen dann nur noch hundert Taler.«
Er stand auf und grüßte, aber auf der Schwelle sagte er noch: »Wenn Sie nicht Talent und Zukunft hätten, wenn ich mich nicht für fleißige junge Leute interessierte, hätte ich Ihnen keine so guten Vorschläge gemacht. Hundert Franken im Monat! Vergessen Sie es nicht. Schließlich ist ein Roman in der Schublade nicht wie ein Pferd im Stall. Er ißt freilich kein Brot; aber er gibt auch keins!«
Lucien nahm sein Manuskript, warf es zu Boden und rief: »Ich verbrenne es lieber!«
»Sie sind ein Dichter!« erwiderte der Alte.
Lucien schlang sein Brot hinunter, trank seine Milch aus und ging fort. Sein Zimmer war nicht groß genug, er hätte sich in ihm um sich selbst gedreht, wie ein Löwe in seinem Käfig im Jardin des plantes. In der Bibliothek Sainte-Geneviève, in die Lucien gehen wollte, hatte er immer in derselben Ecke einen jungen Mann von ungefähr fünfundzwanzig Jahren bemerkt, der mit einer Hingabe und einem Eifer arbeitete, die sich durch nichts ablenken und stören ließen und an denen die richtigen literarischen Arbeiter erkannt werden. Der junge Mann kam ohne Zweifel schon lange hin, die Angestellten und der Bibliothekar selbst erwiesen ihm Gefälligkeiten; der Bibliothekar erlaubte ihm, Bücher mitzunehmen, die der unbekannte Studierende, in dem Lucien einen Bruder im Elend und in der Hoffnung auf die Zukunft erkannte, am nächsten Tage wiederbrachte. Dieser fleißige Arbeiter war klein, mager und blaß, eine schöne Stirn war unter dichten schwarzen Haaren, die wirr darüberhingen, fast verborgen, er hatte schöne Hände und lenkte den Blick selbst der Gleichgültigen auf sich durch eine unbestimmte Ähnlichkeit, die er mit dem Porträt Bonapartes auf einem Stich nach Robert Lefèbvre hatte.
Weitere Kostenlose Bücher