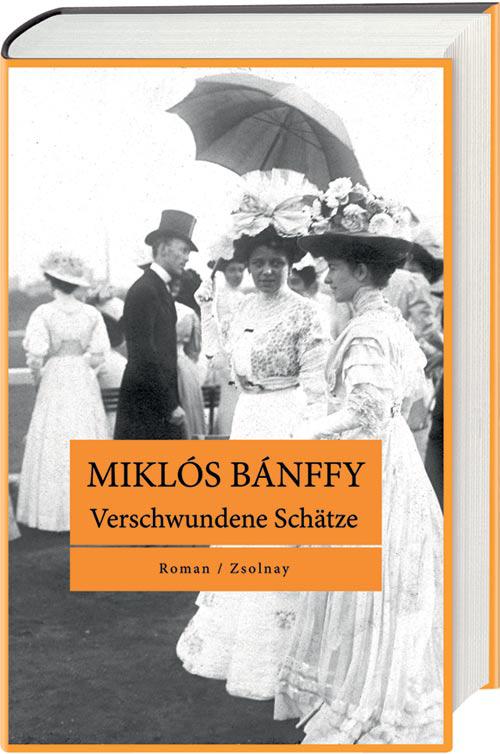![Verschwundene Schätze: Roman (German Edition)]()
Verschwundene Schätze: Roman (German Edition)
Wandlungen unterworfen, als wäre sie ein organisches Wesen. Sie stand so richtig im Bund mit dem befestigten Schloss von Dénestornya auf dem Hügel, das ebenso alt und vielschichtig war und sich dem Zeitgeist stets auf dieselbe Art angeglichen hatte. Hier unten wie dort oben berichtete alles von der Geschichte der Abádys. Eine lange Inschrift am Rand der Kanzel verkündete: »Verfertiget zum Ruhme Gottes des Allmächtigen von L.B. György Abády Statuum Praes. Anno 1690.« Auf dem Baldachin und der Kanzel hatte man das Wappen der Familie abgebildet, begleitet von der Jahreszahl 1740, und in einer rollwerkartigen Einfassung stand das Monogramm »C.D.A.« des Oberstallmeisters Dénes Abády; eng gerahmt, folgten die Wände entlang die Todesanzeigen der Familie, für die Frauen in doppelten, für die Männer in einfachen Wappen, wo auf rotem Feld der goldene Greif des Tomaj-Geschlechts sich mit ausgebreiteten Flügeln reckte. Unter jedem stand verzeichnet, welche Amtswürde der Verstorbene bekleidet hatte. Gegenüber der Bank der Familie hatte man die Todesanzeigen von Bálints Vater und Großvater untereinander aufgehängt. Er las die Namen, wie er dies jedes Mal tat, wenn er die Kirche besuchte, und seine Gedanken flogen zurück in die Vergangenheit, in seine Kinderzeit.
Daran, dass sie einst hier zu viert gesessen waren, erinnerte er sich nur noch vage; er hatte beim Tod des Vaters kaum acht Jahre gezählt. Umso lebendiger sah er den alten Péter Abády neben sich, wie er friedlich dasaß, auf dem gleichen Platz wie jetzt die Mutter, und wie seine auffallend kleine Hand auf dem Gesangbuch ruhte, das auch jetzt vor ihnen lag. Sein gepflegtes Gesicht, das feine Profil, sein gelocktes, weißes Haar blieben während des ganzen Gottesdienstes regungslos, und Bálint schien, als fühle er immer noch den Zigarrenrauch und den Duft der Rasierseife, die für seinen kindlich scharfen Geruchsinn die Nähe von Großpapa bedeutet hatten. Das Epitaph an der Wand verkündete vergeblich: »… 3. Nov. 1892«. Für ihn lebte er immer noch.
Ebenso das, was er ihm als Lehre mitgegeben hatte. Das, was er einmal beim Weggang aus dieser Kirche dem damals fünfzehnjährigen Halbwüchsigen sagte. Sie hatten zu dritt die Kirche verlassen und strebten dem Herrenhaus zu, denn am Sonntag pflegten sie immer beim alten Herrn zu Mittag zu essen. Bálint hatte eine Bemerkung etwa dieser Art gemacht: »Wie großartig, dass hier alles die Abádys geschaffen haben!«
Herr Péter blieb stehen. Einen Augenblick musterte er den Jungen scharf. Ihm ging möglicherweise der Gedanke durch den Kopf, dass sein Enkel leicht von der Mutter den Familienhochmut erben könnte; sie, die Alleinerbin des gewaltigen Schlosses, hatte sich von Kindesbeinen an als mächtige Prinzessin gefühlt. Vielleicht wollte er solchen Empfindungen wehren. Lächelnd sprach er. Womöglich lächelte er in der Absicht, die in seinen Worten steckende Zurechtweisung zu verschleiern. Dies sagte er: »All das, mein Sohn, ist keineswegs großartig, sondern selbstverständlich. Früher, zu Zeiten der Leibeigenschaft, war alles Eigentum des Gutsherrn. Darum gehörte es zu seinen moralischen Pflichten, sich um alles zu kümmern, zu bauen und ausbessern zu lassen. Dass unsere Familie dem entsprach, beweist nur so viel, dass sie ihrer Pflicht jederzeit nachkam, sonst nichts. Und dies soll auch für dich die einzige Lehre sein.«
Eine Weile schwieg er. Mittlerweile hatten sie das Tor des Kirchhofs hinter sich gelassen. Vielfarbige Blütenspaliere hochstämmiger Rosen begleiteten sie. Der alte Herr blieb stehen. Er schnitt ein paar Blumen ab, mit genauen Handbewegungen entfernte er die Dornen, und galant überreichte er den Strauß seiner Schwiegertochter. Dann hob er von neuem an: »Es ist ebenso wenig überraschend, dass unter unseren Vorfahren viele eine führende Stellung innehatten. Ihre gesellschaftliche Lage, ihr Vermögen und ihre Familienverbindungen erklären das hinlänglich. Grund zur Zufriedenheit hat man nur dann, wenn sie sich ihrer Aufgabe ehrenhaft entledigten. Bei den meisten war dies denn auch so. Familiendünkel aber ist immer lächerlich und schädlich. In einer einzigen Form kann er eine Quelle von Kraft sein – ich habe hierüber viel nachgedacht. Dann nämlich, wenn das Familienbewusstsein sich nicht nach außen, gegen andere richtet, sondern nach innen, wenn es einzig uns selber gilt. Wenn man sich nicht geringer achtet als sonst irgendjemanden in der Welt. Denkt
Weitere Kostenlose Bücher