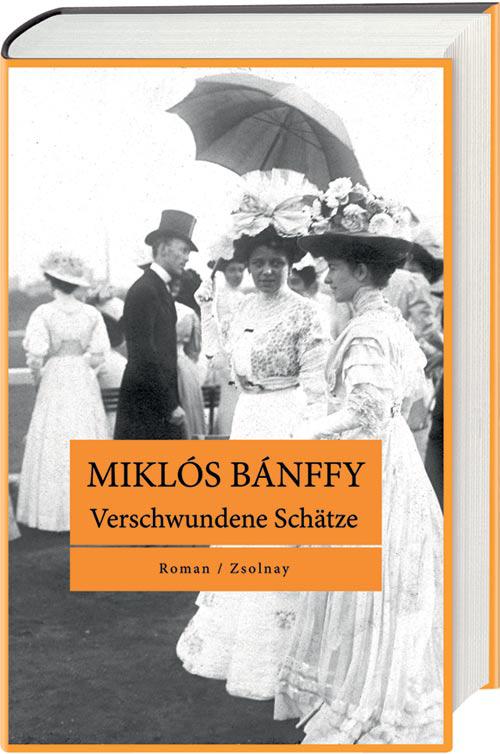![Verschwundene Schätze: Roman (German Edition)]()
Verschwundene Schätze: Roman (German Edition)
einzustellen. Das Oberhaus versammelte sich überhaupt nicht mehr, weil jede gesetzgebende Arbeit schon vor Monaten aufgehört hatte. In Wirklichkeit, dachte Bálint, ist es auch mit der Regierung und der Mehrheit vorbei, so wie man manchmal im Staub eine scheinbar heile, vom Leben aber schon längst verlassene Insektenhülle findet. Und so weit hatten diese Politiker das Land gebracht, Leute, die man sonst größtenteils für die eifrigsten und tüchtigsten Persönlichkeiten halten darf, Anführer, unter denen Andrássy und Wekerle weit erfahrenere Staatsmänner und auch die anderen wohlmeinend, hochbegabt und selbstlos sind.
Als laste ein Fluch über uns …
Die Tage und Wochen danach vergingen wieder eintönig. Die allgemeine Gleichgültigkeit schien ihren bleiernen Mantel auch über Bálint auszubreiten. Dass er lebte, spürte er nur, wenn er an Adrienne schrieb.
Am Anfang schickte er ihr nur gelegentlich Briefe, deren Zahl nahm aber, wie die Zeit verging, immer mehr zu. Ende Oktober schrieb er ihr schon jeden zweiten oder dritten Tag. Sollte man in Almáskő aufmerksam werden, sollte es zu üblen Folgen kommen – was verschlug’s? Im Gegenteil, umso besser! Denn sie könnte sich ja endlich aus der Hölle voller Asche befreien, in der sie lebte. Seine Schreiben mehrten sich, sie drückten sein Verlangen immer glühender aus, er forderte immer offener. Und da er seine Briefe wohlüberlegt verfasste, jedes Wort und jedes Argument erwog, wirkte das, was er auf diese Weise zu Papier brachte, in der Tat vorzüglich. Er suchte alle Ausdrücke zusammen, von denen er wusste, dass sie Addy wehtun würden. Dies wollte und musste er tun, um sie zum Handeln zu bewegen. Er schilderte ihr sein Seelenelend, sein Dasein in der Verbannung. Dass er allein in einem dunklen Hotelzimmer lebe, dass er sich im Traum jede Nacht wieder in Dénestornya sehe, von dem er sich gewaltsam gelöst hatte. Er schrieb ihr, dass er sogar zur Arbeit unfähig sei, da ihn nichts mehr interessiere.
Sie bekam von ihm auch anderes zu lesen. Er war zufällig Lili Illésváry begegnet, die sich in Gesellschaft der Szent-Györgyis in Budapest auf der Durchreise befand, und hatte zusammen mit ihnen zu Mittag gespeist. Er wurde abermals nach Jablánka eingeladen, und Lili schenkte ihm ein Lächeln, als sie sagte: »Ich werde auch dort sein.« Damals war ihm in den Sinn gekommen, dass sich dies brauchen ließe; vielleicht würde es ihm gelingen, die Frau eifersüchtig zu machen. Er berichtete folglich, dass er sich im Sommer am Abend beim Jenkins-Spiel im Park-Club dabei ertappt habe, dieses Mädchen zu begehren. Und er pries sie, wie lieb und hübsch sie sei, und zitierte ihre Schmeichelworte. Auch das war eine Grausamkeit, doch vielleicht würde es wirken.
Am meisten aber sprach er über den kommenden Sohn, wie wahnwitzig er sich nach ihm sehne. Und dieses stets wiederkehrende Thema verstärkte sich immer mehr. Er forschte nach allen Gründen, die zwingend notwendig machten, dass der Sohn auf die Welt kam. Und wie er beim Schreiben – auf der Suche nach neuen Einzelheiten – immer tiefer in die eigene Seele hinabstieg, wurde das Verlangen übermächtig. In seinem letzten Brief stand kaum etwas anderes mehr; das Bild des künftigen Kindes und dasjenige der Frau gingen beinahe ganz ineinander über. Als wäre ihr wundervoller Leib nur noch das vollkommene Mittel, um das Ziel ihrer Liebe zu erlangen.
Adriennes Antworten wurden allmählich dünner. Anfänglich hatte sie noch Gründe angeführt, Erklärungen gegeben: Jetzt sei es nicht möglich, noch nicht … immer noch nicht. Und manchmal erwähnte sie in ihren Briefen die Verantwortung. Dann verkürzten sich ihre Schreiben, immer heftigere, klappernd abgehackte Worte fielen, wie das Herz schlägt. Schließlich nur noch so viel: »Ich denke an Dich … Quäle mich nicht … Du weißt nicht … Du weißt nicht …« Nur so viel. Die kleine Tochter erwähnte sie schon lange nicht mehr. Bálint spürte, dass er den richtigen Weg gewählt hatte. Er schickte ihr umso erbarmungslosere Briefe, wiewohl ihm beim Schreiben das Herz blutete.
Schließlich brachte die Post einen langen Brief aus Siebenbürgen. Er war vom zehnten November datiert. »Ich halte das nicht mehr aus«, schrieb die Frau, »ich halte das nicht aus …«
Ihr weiteres Anliegen trug sie beinahe mit geschäftsmäßiger Trockenheit vor. Möge geschehen, was wolle, sie habe beschlossen, den Versuch einer Scheidung zu unternehmen. Jetzt.
Weitere Kostenlose Bücher