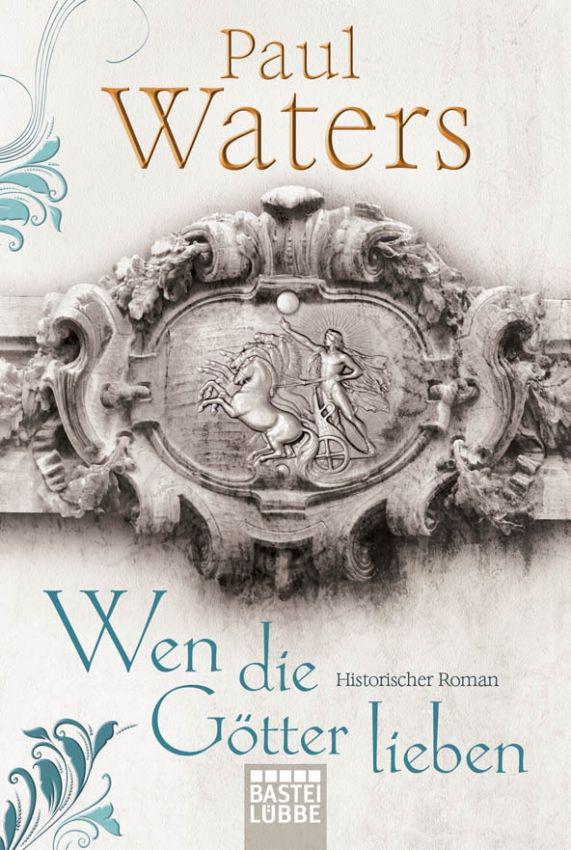![Wen die Götter lieben: Historischer Roman (German Edition)]()
Wen die Götter lieben: Historischer Roman (German Edition)
änderte sich kaum.
»Danke, Präfekt. Sonst noch etwas?«
Florentius schüttelte den Kopf. Der selbstgefällige Zug um den Mund war verschwunden. Selbst er schien begriffen zu haben, dass er zu weit gegangen war.
»Dann ist die Besprechung zu Ende. Du wirst mich entschuldigen.« Er wandte sich dem Hauptmann der Pioniere zu,der sichtlich empört an der Wand stand, und fuhr nach kaum merklicher Pause fort: »Wir wollten gerade die Vertäuung der Brücke inspizieren, nicht wahr? Dann sollten wir das tun, solange es noch hell ist.«
Damit trat er nach draußen, und der Hauptmann eilte ihm hinterher.
Obwohl ich viel Zeit mit Julian verbrachte, erfuhr ich erst spät, dass er verheiratet war, und auch nur von dritter Seite; er selbst hatte nie über seine Gemahlin gesprochen.
Sie war etliche Jahre älter als er, und er war zu der Ehe verpflichtet worden, als er zum Cäsar ernannt worden war. Sie hieß Helena und war Constantius’ Schwester. Einmal hatte ich sie in Paris kurz gesehen, als sie eine Kolonnade entlang zu ihren Gemächern eilte, eine untersetzte, ungelenke Frau mit glatten braunen Haaren und kurzen Beinen. Ich glaube nicht, dass die Eheleute sich auch nur den Anschein gaben, einander zu lieben. Und das wunderte mich nicht, denn wenn sie jemandem ähnelte, dann ihrem Bruder, dem Kaiser, was gewiss dazu angetan war, für Kühle im Ehebett zu sorgen.
Man hörte jedoch nie, dass Julian in seinen Gemächern Frauen oder junge Knaben empfing. Von den Philosophielehrern in Athen hatte er gelernt, dass ein weiser Mann Herr seiner Leidenschaften ist. Er verachtete Grobheit in allen Dingen und hielt sich zugute, seine Gelüste im Zaum halten zu können. Doch ich vermutete, dass seine Zurückhaltung ebenso viel mit Schüchternheit zu tun hatte, und er hielt sich wohl auch nicht für anziehend. Außerdem verabscheute er den Gedanken, sich jemandem aufzudrängen. Er hatte zu viel Machtmissbrauch erlebt und wollte sich diesem Vorwurf nicht selbst aussetzen müssen.
Am Abend nach dem Essen ging ich mit Marcellus zum Fluss hinunter. Vom Wasser stieg Nebel auf. Es roch nach nassem Laub und Uferschlamm. Fackeln beschienen die Bootsbrücke und die Wachhütte am Ufer. Wir schlenderten die Böschung hinunter. Die Boote waren miteinander vertäut; der Steg, der darüberführte, war fast fertig. Wir grüßten die Wächter und gingen leise plaudernd weiter.
Irgendwann hielt Marcellus inne. »Schau mal«, sagte er und deutete mit einer Kopfbewegung in den Nebel.
Ich folgte seinem Blick. Dort stand eine einsame Gestalt und spähte über das Wasser. Ich erkannte die breiten Schultern unter dem abgenutzten Soldatenmantel. »Wir sollten uns nicht bemerkbar machen«, sagte ich und zog Marcellus am Ärmel. »Nach dem heutigen Tag möchte er sicher allein sein.«
Doch als wir abschwenkten, hob er den Arm und rief, wir sollten uns zu ihm gesellen.
Eine Zeit lang schaute er weiter schweigend über den Rhein auf den nebelverhangenen Waldsaum. Dann sagte er melancholisch: »Immer kommt die Nacht ins Spiel. Sie sind irgendwo dort drüben, beobachten uns wie Wölfe und warten nur darauf, dass wir straucheln.«
Um seinen Schmerz ein wenig zu zerstreuen, sagte ich: »Deine Siege haben sich herumgesprochen. Sie werden es sich zweimal überlegen. Schon jetzt hast du mehr erreicht, als alle anderen für möglich gehalten haben.«
Er nickte düster und zog den Mantel straffer.
»Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn man hier am Rand der Zivilisation steht, vor sich die endlose Wildnis, dann fühlt man seine Verantwortung. Der Tod ereilt uns alle, denn das liegt in unserer Natur, doch Sklaven des Schicksals sind wir nur aus eigenem Entschluss.«
Er wurde wieder still. Irgendwann fuhr er fort: »Ich habe mein Leben in Athen geliebt, wo keine Frage verboten war, kein Thema aus Furcht vor Häresie vermieden wurde. Ich habe geweint, als ich von dort weggerufen wurde, geweint über das Ende meines Glücks. Und jetzt bin ich hier als Soldat und führe Krieg. Aber ich kämpfe, damit diese Männer in Athen inFreiheit leben können, damit sie sagen können, was sie denken, und ein wenig Licht ins Dunkel bringen.« Er deutete auf den Wald. »Wo sind ihre Philosophen? Wo sind ihre großen Bibliotheken und Städte? Sie wollen nicht besitzen, was wir haben, sie wollen es nur zerstören. Sie würden einen Philosophen abstechen wie jeden anderen, wenn wir sie ins Land ließen.«
Der Wind regte sich seufzend und rauschte durch die Bäume. Hinter uns
Weitere Kostenlose Bücher