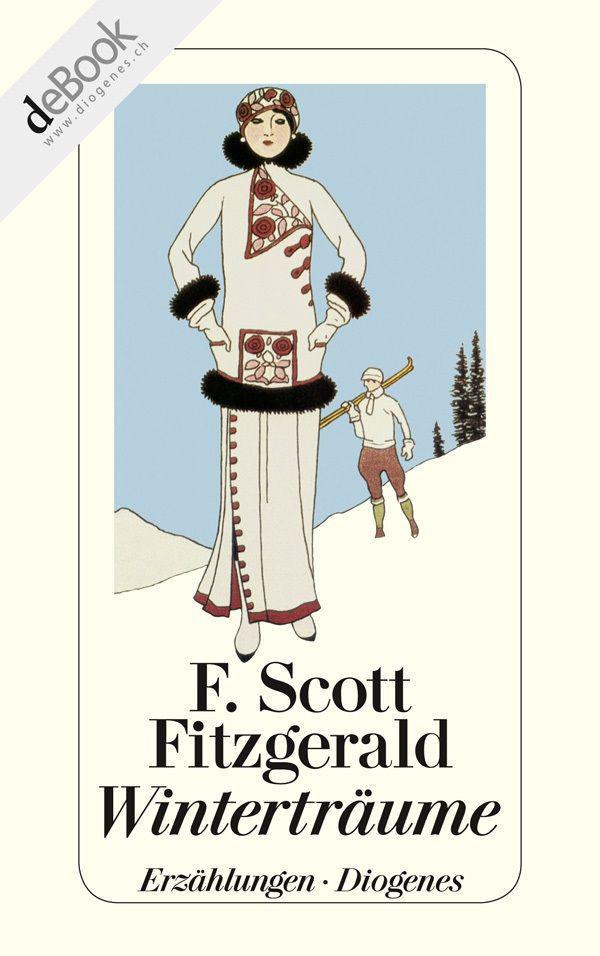![Winterträume]()
Winterträume
Dickeys?«
»Ja.«
»Ist Mr. Charles Abbot da?«
Diana glaubte, ihr Herz höre auf zu schlagen, als sie die Stimme erkannte – es war das blonde Mädchen aus dem Café.
»Was?«, fragte sie benommen.
»Ich möchte bitte auf der Stelle mit Mr. Abbot sprechen.«
»Sie – Sie können ihn nicht sprechen. Er ist gegangen.«
Eine Pause. Dann die argwöhnische Stimme des Mädchens: »Er ist nicht gegangen.«
Diana schloss die Hand fester um den Hörer.
»Ich weiß, wer da ist«, die Stimme wurde immer lauter und hysterischer, »und ich möchte mit Mr. Abbot sprechen. Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen und er es herausfindet, können Sie was erleben.«
»Seien Sie still!«
»Wenn er gegangen ist, wo ist er denn dann jetzt?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wenn er nicht in einer halben Stunde bei mir in der Wohnung auftaucht, weiß ich, dass Sie lügen, und ich –«
Diana legte den Hörer auf und ließ sich wieder aufs Bett fallen, des Lebens zu müde, um nachzudenken oder sich aufzuregen. Draußen auf dem Rasen sang das Orchester, und die Wörter wehten mit der Brise zum Fenster herein.
»Lis-sen while I – get you tole
Stop foolin’ ’round sweet – Jelly-Roll…«
Sie hörte zu. Die Negerstimmen waren wild und laut – diese Tonart hatte das Leben, eine sehr rauhe Tonart. Wie entsetzlich hilflos sie war! Ihr Bitten war blutleer, kraftlos, lächerlich im Vergleich zu der barbarischen Dringlichkeit des Verlangens, das jenes andere Mädchen zum Ausdruck brachte.
»Just treat me pretty, just treat me sweet
Cause I possess a fo’ty-fo’ that don’t repeat.«
Die Musik sank auf ein seltsames, bedrohliches Moll herab. Es erinnerte sie an etwas – eine Stimmung aus ihrer Kindheit –, und eine neue Atmosphäre schien um sie herum zu entstehen. Es war keine klare Erinnerung, sondern vielmehr ein Strom, eine Welle, die ihren ganzen Körper erfasste.
Diana sprang auf und tastete im Dunkeln nach ihren Schuhen. Den Rhythmus des Liedes im Kopf, biss sie mit einem klackenden Geräusch die kleinen Zähne zusammen. Sie spürte, wie in ihren Armen die festen Golfmuskeln zuckten und sich anspannten.
Sie lief hinunter in die Diele, öffnete die Tür zum Zimmer ihres Vaters, schloss sie vorsichtig hinter sich und trat an den Schreibtisch. Was sie suchte, lag in der obersten Schublade und hob sich schwarz und glänzend von den fahlen, bleichen Umschlägen ab. Ihre Hand legte sich um den Griff, und mit ruhigen Fingern nahm sie das Magazin heraus. Es waren fünf Kugeln darin.
Wieder in ihrem Zimmer, rief sie in der Garage an. »Bitte bringen Sie meinen Roadster zum Seiteneingang, sofort!«
Sie hörte die Verschlüsse reißen, als sie sich hastig aus ihrem Abendkleid wand, ließ es als weiches Knäuel auf den Boden fallen und zog stattdessen einen Golfpullover an, einen karierten Rock und einen alten blau-weißen Blazer, an dessen Kragen sie eine längliche Diamantbrosche befestigte. Dann setzte sie sich eine Schottenmütze auf das dunkle Haar und warf, bevor sie das Licht löschte, einen Blick in den Spiegel.
»Also los, Diamond Dick!«, flüsterte sie laut.
Mit einem leisen Aufschrei versenkte sie die Pistole in der Tasche ihres Blazers und eilte aus dem Zimmer.
Diamond Dick! Der Name war ihr einst von einem grellen Buchumschlag ins Auge gesprungen und versinnbildlichte ihr kindliches Aufbegehren gegen ihr weich gepolstertes Leben. Diamond Dick war sein eigenes Gesetz, er fällte seine Urteile mit dem Rücken zur Wand selbst. Wenn die Gerechtigkeit auf sich warten ließ, schwang er sich in den Sattel und galoppierte in Richtung Berge, denn dank der Unfehlbarkeit seiner Instinkte war er härter und höher als das Gesetz. Sie hatte in ihm eine Art Gottheit gesehen, grenzenlos erfinderisch, grenzenlos gerecht. Und das Gebot, das er auf den billigen, schlecht geschriebenen Seiten für sich aufstellte, lautete, zuerst und vor allem zu behalten, was ihm gehörte.
Anderthalb Stunden nachdem sie in Greenwich aufgebrochen war, parkte Diana ihren Roadster vor dem Restaurant Mont Mihiel. Die Theater luden bereits ihr Publikum auf dem Broadway ab, und ein halbes Dutzend Paare in Abendgarderobe sahen neugierig zu ihr hin, als sie durch die Tür geschlurft kam. Einen Augenblick später sprach sie mit dem Oberkellner.
»Kennen Sie ein Mädchen namens Elaine Russel?«
»Ja, Miss Dickey. Sie kommt recht oft hierher.«
»Könnten Sie mir wohl sagen, wo sie wohnt?«
Der Oberkellner überlegte.
»Finden Sie es heraus«, sagte
Weitere Kostenlose Bücher