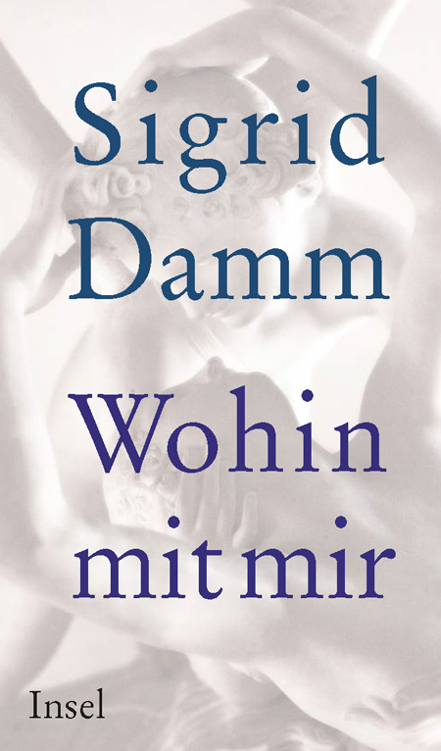![Wohin mit mir]()
Wohin mit mir
Jede Frage nach Sinn und Effektivität des Einsatzes in Afrika verbot sich. Ebenso die nach ihrer Wirtschaft. In unseren Gesprächen in Leipzig und Berlin – ich hatte die compañeros auch bei mir zu Hause zu Gast – versuchte ich zuweilen, ihre absurde und kuriose Verwerfung jeglicher Art von Privatinitiative zu thematisieren. Vergeblich. 1978 sah ich, die wirtschaftliche Lage war äußerst angespannt, fast alles gab es auf Bezugsscheine, angefangen von den primitivsten Dingen wie Seife. Die Häuser in der Altstadt wirkten verwahrlost, die kleinen Kneipen, in denen wir vor vierzehn Jahren Mojito und Daiquiri getrunken hatten, waren überwiegend geschlossen, und das bereits 1964 abenteuerliche Aussehen der Autos, fehlende Türen, verrostete, nur noch halb vorhandene Karosserien, hatte sich dramatisch verschärft. Aber niemand hungerte. Niemand klagte. Es sei denn über einen unstillbaren Bildungshunger. Bei den offiziellen Gesprächen, den Arbeitsessen im Hochhaus von »Habana libre« wie bei den Spaziergängen unter vier Augen: immer dieser ungebrochene revolutionäre Enthusiasmus.
Wie lange kann man für ein ganzes Volk die Idee des Selbstopfers aufrechterhalten? (Noch heute singen die kubanischen Kinder: Wir werden sein wie Che . Heute wallfahren sie nach der Provinzhauptstadt Santa Clara, wo seit Oktober 1997 die in Bolivien am Rande des Flugfeldes von Vallegrande geborgenen sterblichen Überreste Che Guevaras in einem eigens dafür errichteten Mausoleum bestattet sind.)
Das auf der Erde liegende Poster. Das Porträt von Alberto Díaz, das inzwischen zum meistreproduzierten Foto der Geschichte geworden ist. Hat sich für mich nicht inzwischen ein anderes Bild darüber geschoben? Das des toten Che, aufgebahrt im Waschhaus von Vallegrande, einen Tag nach seiner Exekution. Che Guevara mit nacktem Oberkörper, die toten Augen offen, er scheint zu lächeln; gelassen, ruhig wirkt er, schön; eine Sanftheit geht von ihm aus. Eine Aufnahme des Fotografen Freddy Alborta. Die Assoziation zum »Der tote Christus« von Andrea Mantegna und einem gleichnamigen Bild des jungen Holbein. Wie hätte Caravaggio den Toten gemalt? Der Christus-Gedanke bekam zusätzlich Nahrung durch einen der dreißig Journalisten und Bildreporter, die von der Presseagentur UPI nach Vallegrande gerufen worden waren. Der Franzose Jean Lartéguy berichtet, daß ein Bauer aus der Umgebung (kein einziger hatte sich den Guerilleros angeschlossen, im Gegenteil, von einem Bauern waren sie verraten worden), daß dieser Bauer an den zwischen zwei toten Gefährten aufgebahrten Che Guevara herangetreten sei und gesagt habe: Gott verzeih mir, man könnte glauben, es sei Christus zwischen den beiden Schächern.
Die Imitatio Christi. Auch Fidel Castro griff sie bei der Trauerfeier der Hunderttausende in Havanna auf. Che habe sein Blut für die Erlösung der Ausgebeuteten und Unterdrückten, für die Armen und einfachen Menschen vergossen, sein Tod werde langfristig wie eine Saat sein …
Ein Christus der Gewalt? Oder nicht eher ein Don
Quijote? So sah er sich selbst. Im Abschiedsbrief an seine Eltern vom April 1965 heißt es: Mit meinen Fersen spüre ich wieder die Rippen meiner Rosinante, ich mache mich erneut auf den Weg mit meinem Schild auf dem Arm.
Ist nicht eher, so frage ich mich heute, Fidel Castro dieser Don Quijote, der fünfundachtzigjährige, kranke Castro kämpft noch immer; mit verrosteter Lanze, blind für seine Irrtümer, ein Ritter von der traurigen Gestalt.
Rückblickend ist Che Guevara für mich keineswegs der vollkommenste Mensch unserer Zeit, als den ihn Jean-Paul Sartre bezeichnete. Auch nicht der neue Mensch des 21. Jahrhunderts, zu dem er sich selbst stilisierte. Das ist er für mich zu allerletzt. Seine Überzeugung, daß man Gewalt bis zum Selbstopfer ausüben müsse, und sich daraus die allmähliche Geburt eines neuen Menschen ergebe . Dieses Selbstopfer forderte er nicht nur von sich, sondern in Zusammenhang mit der Kuba-Krise 1962 von Millionen Kubanern. Sein schockierender Satz vom schaurigen Beispiel eines Volkes, das bereit ist, sich im Atomkrieg aufzuopfern, damit seine Asche als Fundament einer neuen Gesellschaft dient.
In seiner »Botschaft an die Völker der Welt« verteidigt Guevara den Haß als Faktor des Kampfes. Der unnachgiebige Haß gegenüber dem Feind , heißt es, der weit über die natürlichen Schranken eines Menschenwesens hinaustreibt und es in eine wirksame, gewalttätige, auswählende und kalte
Weitere Kostenlose Bücher