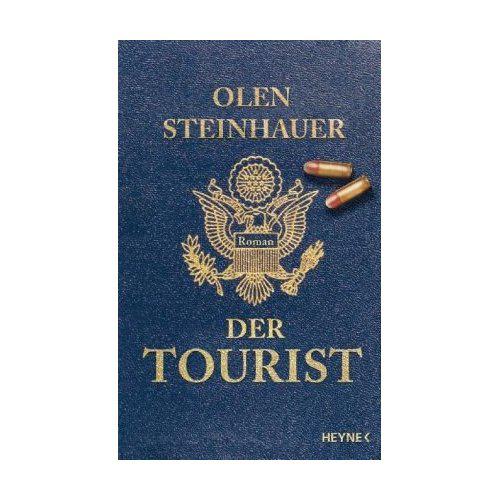![Word-OleSte-DerTou]()
Word-OleSte-DerTou
Dokumente darin hatten nichts mit der Company zu tun. Er hatte sie schon vor Jahren zusammengetragen, nachdem er vom tödlichen Autounfall einer Familie - Mann, Frau, kleine Tochter - gehört hatte. Er hatte ihre Sozialversicherungsnummern recherchiert und sie behutsam wieder zum Leben erweckt. Bankkonten, Kreditkarten, ein kleines Haus in New Jersey und ein Postschließfach in der Nähe dieses Anwesens. Zuletzt beantragte er für alle Pässe und schickte die Fotos seiner eigenen Familie mit. Wenn man den offiziellen Urkunden in der Kassette glaubte, war die Familie Dolan - Laura, Lionel und die kleine Kelley - gesund und munter.
Er schob sich die drei Pässe und zwei Kreditkarten in die Jackentasche und sperrte alles wieder zu. Erst als er wieder auf der Hauptstraße und in der Nähe der Stelle war, wo er vorher die Richtung gewechselt hatte, steckte er den Akku ins Telefon zurück und schaltete es an.
Er hätte nicht genau sagen können, warum er diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen hatte. Wegen Fitzhugh vielleicht, der ihm im Nacken saß. Oder wegen Angela, die plötzlich nicht mehr da war, und wegen der beklemmenden Ahnung, dass sich hinter ihrem Tod weit mehr verbarg, als er im Augenblick überblicken konnte. Der Boden unter seinen Füßen schien ins Wanken geraten. Manchmal beschlich ihn dieses Gefühl, entweder aus handfesten Gründen oder aus schlichter Paranoia, und es beruhigte ihn, die Papiere der Dolans abzuholen und zu wissen, dass er mit seiner Familie jederzeit in den anonymen Strömungen menschlicher Bürokratie untertauchen konnte.
Zu Hause lauschte er wieder einmal an der Tür. Kein Fernseher, doch er konnte Stephanie hören, die leise »Poupee de eire, poupee de son« sang. Er schloss auf und stellte seine Tasche bei der Garderobe ab, bevor er mit der Stimme eines TV-Gemahls rief: »Liebling, ich bin da!«
Stephanie hüpfte aus dem Wohnzimmer und warf sich ihm so heftig in die Arme, dass es ihm den Atem verschlug. Tina folgte ihr in langsamem Tempo. Gähnend fuhr sie sich durch das zerzauste Haar. »Schön, dich zu sehen.«
»Kater?«
Sie schüttelte den Kopf und strahlte ihn an.
Zwanzig Minuten später verdrückte Milo auf dem Sofa ein aufgewärmtes Gericht. Tina beschwerte sich über den Gestank, der an ihm hing - wahrscheinlich wieder mal Zigaretten. Und Stephanie legte ihm ihre Pläne für Disney World dar, ehe sie von der Couch kletterte, um nach der Fernbedienung für die Glotze zu suchen.
Schließlich fragte Tina: »Willst du mir davon erzählen?« Milo schlang den letzten Bissen hinunter. »Lass mich erst mal duschen.«
21
Tina beobachtete ihn, wie er sich stöhnend vom Sofa hochstemmte und mit schweren Beinen aus dem Zimmer torkelte. Irgendwie kam es ihr fast surreal vor, dass Milo einfach so von dem Ausflug zurückgekehrt war, bei dem seine älteste Freundin gestorben war, und jetzt wieder alles normal sein sollte.
Sie hatte Milo unter sehr extremen Umständen kennengelernt - nicht einmal ihre Eltern wussten, was damals in Venedig passiert war. Auf einmal war er da gewesen. Keine Erklärungen, keine Entschuldigungen. Fast als hätte er jahrelang an dieser feuchten venezianischen Straßenecke auf sie gewartet, auf die Frau, der er sein Leben widmen konnte.
»Ich bin ein Spion«, vertraute er ihr eine Woche nach Beginn ihrer stürmischen Affäre an. »Oder war es zumindest bis zu dem Tag, an dem wir uns getroffen haben.«
Sie hatte darüber gelacht, aber es war kein Witz. Als sie ihn zum ersten Mal sah, hatte er eine Pistole in der Hand. Sie hatte ihn für eine Art Polizisten gehalten, einen Privatermittler vielleicht. Aber ein Spion? Nein, auf diese Idee wäre sie nie verfallen. Und warum hatte er diese Arbeit nach ihrer Begegnung aufgegeben?
»Ist mir wahrscheinlich zu viel geworden. Einfach zu viel.« Als sie nachhakte, überraschte er sie mit einem Geständnis, an dem sie eine Zeit lang zu knabbern hatte: »Manchmal war ich kurz davor, mich umzubringen. Nicht um Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. In diesem Job verschafft dir ein Selbstmord keine Aufmerksamkeit. Höchstens die Entlassung. Nein, ich wollte wirklich sterben, damit ich nicht mehr leben muss. Die Anstrengung hat mich in den Wahnsinn getrieben.«
Das warf sie ziemlich aus der Bahn. Wollte sie einen selbstmordgefährdeten Mann in ihrem Leben? Und vor allem in Stephanies Leben?
»Ich bin in North Carolina aufgewachsen. In der Gegend von Raleigh. Als ich fünfzehn war, sind meine Eltern bei einem Verkehrsunfall
Weitere Kostenlose Bücher