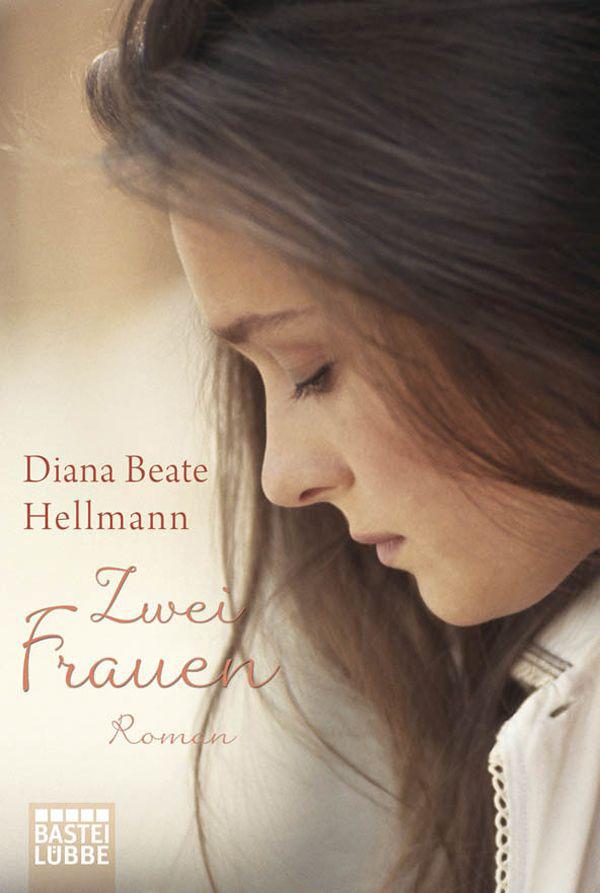![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
die Diagnose, »Blutvergiftung!«
Das löste eine allgemeine Panik aus, die ich in meinem Fieberwahn nur ganz bruchstückhaft mitbekam. Mitten in der Nacht bettete man mich auf eine Trage und raste mit mir durch düstere Gänge; die vorüberflatternden weißen Kittel wurden zu flüsternden Schatten. Dann wurden die Gänge heller, und manchmal stob der Schein einer Neonröhre unter meine Lider, wie bei rasender Autofahrt über eine Allee, wo das Sonnenlicht im Stakkato durch die Baumkronen blitzt. Ich sah die Straße, die ich entlangbrauste, ich sah das satte Grün der Bäume, ihre kräftigen Stämme, die zur lichtschäumenden Welle wurden. Dann war es plötzlich vorüber. Scharfer Karbolgeruch stieß mir in die Nase, und als ich die Augen öffnete, sah ich über mir den Kranz der Operationsscheinwerfer. Grün vermummte Gestalten beugten sich über mich.
»Ganz ruhig, Frau Martin! Das tut jetzt ein bisschen weh, Frau Martin! Hören Sie mich, Frau Martin?«
Ich hörte alles, aber ich verstand nicht, und als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der Intensivstation, und rauschende Apparate umgaben mich, in meine Venen flossen Infusionen und Transfusionen, und das grelle Licht, das mir unbarmherzig in die Augen stach, brannte Tag und Nacht. Manchmal kamen junge Männer, kaum älter als ich, und wuschen mich. Sie entblößten meinen ausgezehrten Körper, und keine einzige Ritze und keine Fuge blieb von ihren Lappen und Läppchen verschont. Sie rieben in meinem Po, und sie scheuerten mein Genitale, sogar die Schamlippen klappten sie auseinander, um mich antibakteriell und keimfrei zu hinterlassen. Dass ich dabei jedes Mal vor Scham weinen musste, verstanden sie nicht. Mit frischem Zellstoff wischten sie mir die Tränen vom Gesicht, und dabei redeten sie tröstend und beruhigend auf mich ein. Sobald sie fort waren, kamen die Mädchen. Es waren hübsche Mädchen mit ungeschminkten Gesichtern, und sie rochen nach Leben. Sie sprachen freundlich, und sie lächelten mich an, und dann beugten sie sich über mich und ergriffen eines meiner Ohrläppchen. Mit einem Gel rieben sie es ein, bis es brannte wie Feuer. Dann schnitten sie mit einem Messerchen hinein, bis das Blut nur noch so floss. Ich wollte schreien und konnte nicht, denn sie erzählten mir etwas von meinen Gaswerten, und dabei sah ich dann in ihre hübschen und ungeschminkten Gesichter und roch ihr Leben und fragte mich nur noch, wie sie nur so hübsch lebendig sein konnten, wenn sie andere Menschen quälten, wie mich. Eine Antwort fand ich nicht, dazu hatte ich viel zu hohes Fieber. Vielleicht gab es aber auch gar keine Antwort.
Insgesamt lag ich knapp drei Wochen dort, und während dieser Zeit spielte mein Körper völlig verrückt. Auf der einen Seite kämpfte er gegen den Krebs, auf der anderen Seite gegen die Chemotherapie. Vornehmlich in dem der Vulva angrenzenden Lymphknotenbereich bildeten sich immer neue und immer schmerzhaftere Abszesse, die jedes Mal operativ eröffnet werden mussten. Die Narkosen zogen lebensgefährliche Herz- und Kreislaufschäden nach sich, und das kettete mich zeitweilig an die Herz-Lungen-Maschine. Darüber hinaus zeigte mein Körper allergische Reaktionen. Die Lymphen schwollen an: an den Händen, an den Füßen, in den Achselhöhlen, in den Leistenbeugen, am Hals – und im Gesicht. Besonders im Lippenbereich machte mir das zu schaffen, denn ich spürte, wie es begann, und konnte es trotzdem nicht aufhalten. »Dicke Lippe« nannten die Ärzte und Schwestern dieses Phänomen, und als ich in einem lichten Moment fragte, wie ich damit denn aussähe, antwortete man mir lachend:
»Wie ein aussätziger Gorilla!«
Das glaubte ich natürlich nicht, überdies störte es mich aber auch nicht. Für kurze Zeit war ich mit meinem Schicksal versöhnt. Ich spürte genau, dass Gott mir meinen großen Wunsch zu sterben nun doch erfüllen wollte. Ich spürte es ganz genau, und das machte mich friedlich.
Mitte November 1976 teilte Professor Mennert meinen Eltern dann tatsächlich mit, es gäbe nun keine Hoffnung mehr für mich.
Diese Eröffnung traf meine Eltern nicht unvorbereitet. Sie hatten lange genug damit gerechnet, und nachdem sie sich weitere vierundzwanzig Stunden mit diesem Gedanken auseinander gesetzt hatten, bat mein Vater, sämtliche Apparate abzuschalten und der Natur freien Lauf zu lassen. Mennert weigerte sich.
»Es steht uns nicht zu, Gott ins Handwerk zu pfuschen«, sagte er.
Mein Vater war empört. »Aber das tun Sie doch schon
Weitere Kostenlose Bücher