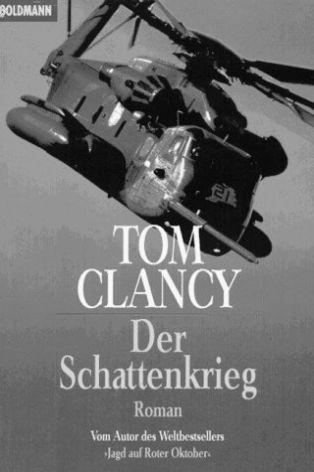![06 - Der Schattenkrieg]()
06 - Der Schattenkrieg
der Geheimdienste war im Lauf der vergangenen Dekade recht zivilisiert geworden. Noch in den fünfziger Jahren war das Stürzen von Regierungen als Mittel der Außenpolitik eine ganz normale Praxis gewesen; Attentate eine zwar seltene, aber ganz reale Alternative zur Ausübung diplomatischen Drucks. Im Fall der CIA hatten das Schweinebucht-Fiasko und eine schlechte Presse wegen einiger Operationen in Vietnam das war immerhin ein Krieg gewesen, und Kriege sind nun mal gewalttätig solchen Übungen weitgehend ein Ende gesetzt. Seltsam, aber wahr: Selbst das KGB befaßte sich nur noch selten mit »nasser« Arbeit einem Ausdruck aus den Dreißigern, der auf der Tatsache beruht, daß Blut nasse Hände macht - und überließ sie lieber Hilfskräften wie den Bulgaren oder, häufiger noch, Terroristengruppen, die solche Dienste als Gegenleistung für Waffen und Hilfe bei der Ausbildung übernahmen. Und, erstaunlich genug, selbst diese Praxis war im Aussterben begriffen. Sonderbar war nur, daß Ryan ein derart energisches Vorgehen gelegentlich für notwendig erachtete - und zwar in zunehmendem Maße, denn die Welt wandte sich von offener Kriegsführung ab und dem Zwielicht staatlich geförderten Terrorismus zu. Einheiten für »Spezialoperationen« stellten eine echte und halbzivilisierte Alternative zu den organisierteren und destruktiveren Formen der Gewalt dar, wie konventionelle Streitkräfte sie ausüben. Wenn der Krieg schon nicht mehr als sanktionierter Mord im industriellen Maßstab ist, argumentierte Ryan, war es dann nicht humaner, Gewalt konzentrierter und diskreter anzuwenden? Das war eine ethische Frage, die nicht unbedingt beim Frühstück erwogen werden mußte.
Doch was ist hier Recht und was Unrecht? fragte sich Ryan. Laut Rechtswissenschaft, Ethik und Religion ist ein Soldat, der im Krieg tötet, kein Mörder. Aber wie war der Begriff »Krieg« zu definieren? Vor einer Generation noch war das einfach gewesen. Nationalstaaten mobilisierten ihre Armeen und Mannen und schickten sie wegen irgendeiner lächerlichen Streitfrage in den Kampf nachträglich stellte sich meist heraus, daß es eine friedliche Alternative gegeben hätte, und das war moralisch akzeptabel. Doch inzwischen nahm der Krieg andere Formen an, und wer sollte da entscheiden, was Krieg war und was nicht? Nationalstaaten. Konnte ein Nationalstaat also seine vitalen Interessen definieren und dementsprechend handeln? Und wie war der Aspekt »Terrorismus« in die Gleichung einzubringen? Vor Jahren, als er selbst das Ziel eines terroristischen Akts gewesen war, hatte Ryan entschieden, daß es sich beim Terrorismus um eine moderne Manifestation der Piraterie handelte, und Seeräuber waren schon immer als Feinde der ganzen Menschheit gesehen worden. Konnte das auch für internationale Rauschgifthändler gelten? Was, wenn sie einen Staat unterwanderten? Wurde dieses Land dann zum Feind der gesamten Menschheit so wie die alten Seeräuber?
»Verdammt«, brummte Ryan. Er wußte nicht, was im Gesetzbuch stand. Und da er Historiker war, nützten ihm auch seine akademischen Grade nichts. Den einzigen Präzedenzfall stellte der Opiumkrieg dar, in dem ein mächtiger Nationalstaat einen echten Krieg geführt hatte, um sein »Recht«, den Chinesen gegen den Willen ihrer Regierung Rauschgift zu verkaufen, durchzusetzen. Doch in diesem Fall hatte die chinesische Regierung den Krieg und damit das Recht verloren, seine Bürger vor illegalem Drogenkonsum zu schützen. Ein beunruhigender Präzedenzfall. Sein akademischer Hintergrund zwang Jack zur Suche nach einer Rechtfertigung. Er glaubte nämlich, daß Gut und Böse als festumrissene und definierbare Kategorien existierten. Doch da das Gesetz nicht auf alle Fragen eine Antwort liefern konnte, mußte er sich manchmal anderswo umsehen. Als Vater verabscheute er Rauschgifthändler. Wer konnte garantieren, daß sich nicht eines Tages seine eigenen Kinder versucht fühlten, das Teufelszeug zu probieren? War er nicht zum Schutz seiner Kinder verpflichtet? Als Vertreter des Nachrichtendienstes seines Landes hatte er diesen Schutz auf alle amerikanischen Kinder auszudehnen.
Und was, wenn dieser Feind begann, einen Nationalstaat herauszufordern? Was den Terrorismus anging, hatten die Vereinigten Staaten ihre Haltung bereits klargemacht: Wer uns herausfordert, geht ein gewaltiges Risiko ein. Nationalstaaten wie die USA verfügten über fast unvorstellbare Fähigkeiten. Sie hielten sich Männer in Uniform, die unablässig die
Weitere Kostenlose Bücher