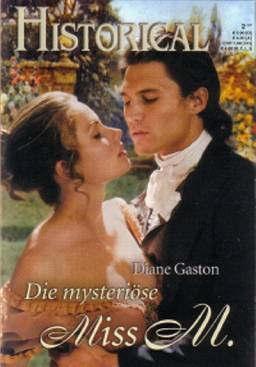![223 - Gaston, Diana - Die mysteriöse Miss M]()
223 - Gaston, Diana - Die mysteriöse Miss M
missbilligst mein Verhalten gegenüber meinem Bruder“, platzte es aus ihm heraus.
„Ich würde deine Entscheidung niemals infrage stellen“, erwiderte sie erstaunt.
„Du glaubst, ich bin zu hart zu ihm.“
„Ich würde niemals …“
Ein Kopfschütteln zeigte an, dass er ihre Worte nicht gelten ließ, woraufhin sie mit zitternden Fingern ihre Gabel zum Mund führte.
Nach acht Jahren Ehe war seine Gemahlin noch immer eine atemberaubend schöne Frau, deren Zurückhaltung der Inbegriff dessen war, was sich für eine Dame geziemte. Er konnte sich nicht über sie beklagen. Serena war folgsam, auch wenn er seine fleischlichen Gelüste ausleben wollte – was er so selten tat, wie er nur konnte. Der Liebesakt war für ihr Empfinden zu schmerzhaft, doch sie sehnte sich nach Kindern, und er wollte sie ihr schenken.
Auch in diesem Punkt hatte er versagt.
Ned leerte sein drittes Glas Wein. „Gehst du heute Abend noch aus, Serena?“
Sie zuckte beim Klang seiner Stimme zusammen. „Nein“, antwortete sie, blickte aber nur kurz in seine Richtung.
Das überraschte ihn. In letzter Zeit hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, Freunde zu abendlichen Veranstaltungen zu begleiten, von denen er sich immer häufiger fernhielt.
„Ich werde mich früh zurückziehen“, erklärte sie und drückte die Fingerspitzen gegen ihre Schläfen. „Ich … ich habe Kopfschmerzen.“
Das war seine Schuld. Er machte sie krank. Er schenkte sich noch ein Glas Wein ein, während er überlegte, dass er seiner Besorgnis Ausdruck verleihen und ihr anbieten sollte, ihr das Pulver gegen Kopfschmerzen zu bringen, sie nach oben in ihr Zimmer zu begleiten und ihr ins Bett zu helfen.
Nichts davon setzte er in die Tat um.
„Wenn du mich entschuldigen würdest …“ Sie stand auf und verließ das Zimmer, ohne auf eine Erwiderung von ihm zu warten. Vermutlich rechnete sie auch gar nicht damit.
Ein Diener kam zu ihm und räumte zügig den Tisch ab. Ned bedeutete ihm, auch seinen noch fast vollen Teller mitzunehmen. Als der Mann ihm dann den Brandy brachte, fragte sich Ned, wie viel sich am Ende des Abends noch in der Flasche befinden würde.
8. KAPITEL
D evlin suchte sich im White’s einen Platz, der weit von den Fenstern entfernt war. Er wollte seinen Brandy in Ruhe trinken können, fernab von neugierigen Passanten draußen auf der Straße. Bevor er sich auf eine erneute Runde durch die feine Gesellschaft machte, um irgendwo Arbeit zu finden, musste er sich erst einmal stärken. Nur warum sollte es an diesem Nachmittag anders als an einem der anderen Tage der vergangenen zwei Wochen sein? Er hatte bei den wenigen Senioroffizieren angefragt, die wie er den Krieg überlebt hatten, und auch keine der denkbaren Verbindungen innerhalb der Familie unversucht gelassen.
Angesichts dieser Misere wäre es ihm sogar lieber gewesen, die kalten, nassen Nächte in der Gesellschaft von Soldaten zu verbringen, die wussten, dass eine Musketenkugel ihrem Leben schon am nächsten Tag ein Ende setzen konnte.
„Darf ich mich zu dir setzen?“
Devlin hob den Kopf und sah den Marquess vor sich stehen. Mit einem Schulterzucken bejahte er die Frage.
Sein Bruder bestellte etwas zu trinken und nahm ihm gegenüber in dem bequemen Sessel Platz. „Wie geht es dir, Devlin?“
Was glaubte Ned wohl, wie es ihm gehen sollte? Er und Bart hatten am Morgen die noch verbliebenen Münzen gezählt und einsehen müssen, dass sie nur noch wenige Tage vom völligen Bankrott entfernt waren.
„Es ist zu ertragen“, erwiderte er.
Ned betrachtete ihn ausdruckslos. Was in seinem Kopf vorging, war Devlin ein Rätsel. Er konnte schweigen und warten, selbst wenn sein Bruder nie wieder ein Wort sagen würde.
„Wie ich höre, hast du dich in der Stadt nach Arbeit erkundigt“, sagte er schließlich in neutralem Tonfall, der keine Gefühlsregung erkennen ließ.
Devlin nickte flüchtig, während der Kellner Neds Bestellung servierte.
„Ohne Erfolg, wenn ich das richtig verstanden habe“, fuhr er fort.
„Es freut mich“, gab Devlin ironisch zurück, „dass du so gut informiert bist. Bedauerlicherweise scheint es Männer wie mich – Soldaten, die nach Arbeit suchen – in der Stadt im Überfluss zu geben.“
„Zu schade.“ Ned trank einen Schluck.
„Es ist auch nicht hilfreich, dass die Männer, die ich anspreche, mich ihren Töchtern vorstellen wollen.“
Weitere Kostenlose Bücher