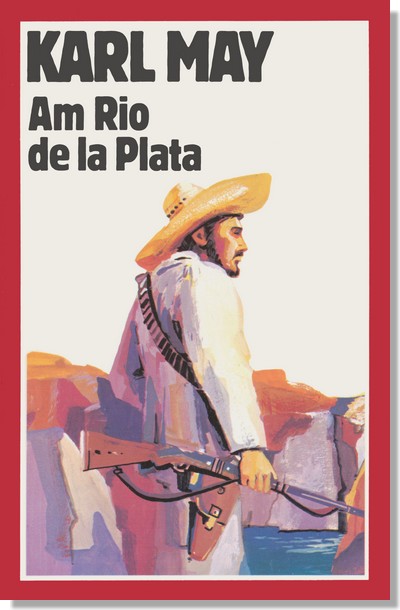![34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata]()
34 - Sendador 01 - Am Rio de la Plata
sollen teil an meiner prächtigen Tertulia nehmen.“
„Das ist nicht möglich, Señora, weil ich dazu eines Anzuges bedarf, welchen ich nicht besitze. Ich muß mir also den Eintritt in ein Paradies versagen, welches mir mit solcher Freundlichkeit angeboten und geöffnet wird.“
Sie strahlte im ganzen Gesicht vor Vergnügen.
„Paradies!“ sagte sie. „Alle Ihre Worte legitimieren Sie als einen Poeta! Aber dieses Paradies soll Ihnen nicht verschlossen bleiben. Sie dürfen in diesem Anzug erscheinen. Ich werde Sie entschuldigen, und Sie können des freundlichsten Empfanges sicher sein. Also, ich reite mit Ihnen, ja?“
„Gewiß.“
„Und Sie nehmen meine Einladung an?“
„Wenn ich überzeugt sein könnte, Nachsicht zu finden, ja.“
„Sie haben nie um Nachsicht zu bitten. Sie werden die Honoratioren und hervorragenden Schönheiten der Stadt bei mir versammelt finden. Nun freue ich mich doppelt auf den heutigen Abend und auf meine Tertulia. Mein Sohn ist auch geladen und wird von Mercedes herüberkommen, wo er jetzt mit seiner Eskadron steht. Er ist Rittmeister und kommandiert unter Latorre, von welchem Sie trotz Ihres kurzen Aufenthaltes vielleicht gehört haben werden.“
„Dies ist allerdings der Fall. Es ist möglich, daß ich Ihrem Sohn eine sehr wichtige Mitteilung zu machen habe. Haben Sie Latorre bereits einmal gesehen?“
„Noch nicht.“
„Dachte es mir! So scheint dem Herrn Rittmeister eine kleine Überraschung bevorzustehen. Doch davon später. Würden Sie mir jetzt gestatten, mich als Ihren Arzt zu betrachten? Sie sind leider im Gesicht von den Splittern der Fensterscheibe verwundet worden.“
Ich führte die Dame an das Wasser zurück, um ihr mit ihrem Taschentuch das Gesicht vom Blut zu reinigen, und bedeckte dann die Risse der Haut mit schmalen Pflasterstreifen; ich hatte Heftpflaster bei mir. Das sah allerdings unschön aus, war aber nicht zu ändern.
Übrigens gehörte die Señora ihrem Aussehen nach keineswegs zu den Xanthippen. Sie war zwar lang und hager und hatte vorhin im Zorn gesprochen. Jetzt aber befand sie sich in ruhiger Gemütsstimmung und machte auf mich den Eindruck einer zwar energischen, dabei aber auch gutmütigen Dame. Sie mochte früher sogar schön gewesen sein, und ihr Benehmen bewies jetzt, daß sie die Herrin eines nach hiesigen Verhältnissen fein zu nennenden Hauses sei.
Als wir zum Wagen zurückkehrten, sah ich, daß eins der beiden gefallenen Pferde, welches sich nicht hatte aufrichten können, ausgesträngt worden war. Man zerrte es an einem Bein auf die Seite, um dort liegen gelassen zu werden. Dabei schnaubte und stöhnte es in einer Weise, welche bewies, daß es große Schmerzen leide. Um nicht von seinen Hufen getroffen zu werden, zog man es an einem Lasso, welcher ihm um das Bein geschlungen worden war.
„Was ist mit dem Tier?“ fragte ich.
„Es hat sich ein Bein gebrochen“, antwortete der Mayoral. „Es kann nicht mehr gebraucht werden.“
„Welches Bein ist es?“
„Das hintere links.“
„Also grad das, an welchem Sie zerren! Denken Sie denn nicht daran, daß Sie ihm dadurch große und unnötige Schmerzen bereiten?“
„Pah! Ein Pferd!“ antwortete er roh.
„So! Was soll nun mit dem Pferd werden?“
„Es bleibt liegen und mag verrecken.“
„Und wird von den Caranchos und Chimangos bei lebendigem Leibe zerrissen. Das Tier ist, den Beinbruch abgerechnet, noch ganz gesund und kräftig. Es kann noch tagelang hier liegen, bis es verschmachtet und ihm das Fleisch von den Knochen gerissen worden ist.“
„Das geht uns gar nichts an! Es ginge nur mich an, nicht aber Sie!“
„Sie irren! Auch die Tiere sind Gottes Geschöpfe. Sie sind nicht da, um nur allein die Qualen des Daseins zu tragen und dann lebendig zerfleischt zu werden. Ich fordere von Ihnen, daß Sie es töten!“
„Dazu ist mir mein Pulver zu teuer!“
Er hatte kein Gewehr bei sich und nur eine alte Pistole im Gürtel stecken. Er wandte sich ab, als ob ihn die Sache nichts mehr angehe und er sie als beendet betrachte. Ich aber hielt dem Pferd die Mündung meines Gewehres an den Kopf und schoß es tot. Kaum war das geschehen, so traten die Peons zusammen und sprachen einige Augenblicke leise miteinander. Dann kam der Mayoral zu mir und sagte, indem er eine sehr strenge Miene zog:
„Señor. Gab Ihnen der Besitzer die Erlaubnis, es zu töten?“
„Nein!“
„So haben Sie es zu bezahlen. Dieses Pferd kostet hundert Papiertaler, welche ich mir jetzt
Weitere Kostenlose Bücher