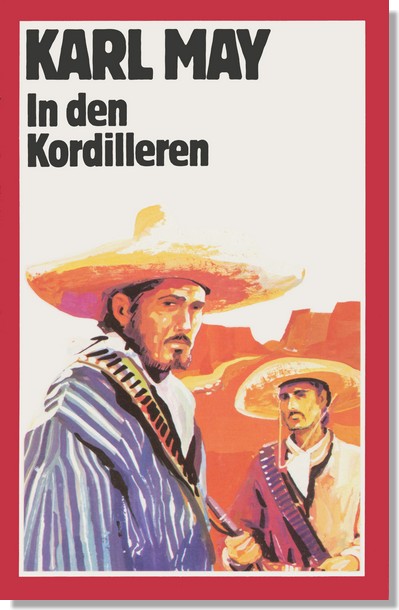![35 - Sendador 02 - In den Kordilleren]()
35 - Sendador 02 - In den Kordilleren
gießt. Wir wateten oft bis über die Knöchel im Schlamm und fast bis an die Knie im Wasser. Aber es ging trotzdem vorwärts. Es war fast ein Wunder, daß Pena sich nicht verirrte.
Gegen Morgen hörte der Regen auf, um nach einer Stunde wieder zu beginnen und gerade dann aufzuhören, als wir aus dem dichten Wald traten, in welchem die Indianer gelegen hatten, und nun die Unglücksstätte vor uns sahen. Aber hier fanden wir keine Spur. Wir schlugen mehrere Kreise, weiter und weiter um die Gegend, durch den Wald, über das Camp, den Sand und die Pampas war nicht ein einziger Fußeindruck zu sehen. Der Regen hatte die Fährten ausgefüllt und verwischt. Als wir uns am Abend so überangestrengt hatten, daß wir uns da niederlegten, wo wir uns gerade befanden, mußten wir alle Hoffnung aufgeben, die Gefährten zu entdecken.
„Gibt es denn gar keine Möglichkeit, sie zu finden, falls sie noch leben?“ fragte Pena.
„Eine einzige. Wir müssen wieder dorthin, von wo wir dem Sendador entwichen sind. Da er mich nicht mehr hat, wird er nun die Gefährten aufsuchen – falls er sie eben nicht schon ermorden ließ.“
„So schlafen wir jetzt einige Stunden und machen uns dann auf die Wanderung!“
Das geschah. Der Körper verlangte Ruhe, aber die Sorge raubte sie ihm. Schon um Mitternacht brachen wir wieder auf. Als es hell geworden war, sahen wir, daß auch unsere gestrigen Spuren vollständig verwaschen waren.
„Das ist sehr gut“, sagte Pena, „denn da hat der Sendador nicht erfahren, wohin wir sind.“
„Nein, das ist nicht gut“, entgegnete ich, „denn da werden wir auch nicht sehen, wohin er sich gewendet hat. Seine Spuren sind ebenso verwischt wie die unsrigen.“
„Aber er ist doch später aufgebrochen. Ich holte Sie noch lange vor Mitternacht ein, während er erst am Morgen hat suchen können.“
„Es hat bis Mittag mit nur einer kurzen Unterbrechung geregnet. Da ist kein Fußeindruck mehr zu finden.“
Es zeigte sich, daß meine Vermutung die richtige war. Als wir uns der Gegend näherten, in welcher ich als Gefangener bei den Indianern gesessen hatte, mußten wir uns außerordentlich in acht nehmen, weil der Sendador sich ja hier befinden konnte. Wir drangen nur unter Anwendung aller Westmannsfinessen vor, was uns viel Zeit kostete, und als wir endlich an der Stelle anlangten, wo die Indianer gelagert hatten, fanden wir sogar das niedergedrückte Moos und Gras wieder aufgerichtet. Nach langem Suchen entdeckten wir den Ort, an welchem die Pferde angebunden gewesen waren. Wir erkannten das an den vielen abgefressenen Zweigen.
Wir begannen nun auch hier Kreise zu schlagen, fanden aber, um den Ausdruck zu gebrauchen, nicht die Spur von einer Spur. Als wir dann am Abend traurig und bis zum Tode ermüdet beieinander lagen, fragte Pena:
„Was nun? Ich bin am Rande meiner Klugheit angelangt.“
„Ich ebenso.“
„Aber wir können doch nicht bis an unser sanftseliges Ende hier sitzen bleiben!“
„Das beabsichtige ich keineswegs. Wir schlafen uns aus und suchen morgen früh noch einmal. Vielleicht entdecken wir doch einen kleinen, wenn auch noch so winzigen Anhalt.“
„Ich habe alle Hoffnung schon längst aufgegeben. Unsere Gefährten sind tot. Bedenken Sie den Haß, den der Sendador auf Gomarra hatte!“
„Zeigen Sie mir ihre Leichname. So lange ich diese nicht sehe, bin ich von ihrem Tod noch nicht überzeugt. Der Sendador war ein Freund der Yerbateros. Warum soll er sie ermorden? Warum den Bruder, den Kapitän und den Steuermann? Vielleicht hat er Gomarra ausgelöscht. Hätte er aber den Befehl gegeben, auch den anderen das Leben zu nehmen, so wäre er kein Bösewicht mehr, sondern geradezu ein Teufel.“
„Das ist er auch. Ich bin des Suchens müde und möchte am liebsten heim.“
„Ohne den Tod unserer Genossen gerächt zu haben?“
„Wir wissen doch nicht, wo der Sendador ist! Wir haben seine Spur verloren!“
„Das ist richtig; aber wir werden sie wiederfinden auf dem Weg nach der Pampa de Salinas.“
„Sie glauben, daß er dorthin geht?“
„Ganz gewiß tut er das.“
„Es hat doch keinen Zweck mehr, da Sie ihm entwischt sind, und er nun niemand hat, der ihm seine Geheimnisse entziffern kann.“
„Aber ich kenne den Ort, an welchem er die Flasche vergraben hat, ziemlich genau. Das weiß er, und so muß er annehmen, daß ich nun hingehen werde, um sie mir zu holen. Meinen Sie nicht, daß dies eine hinreichende Veranlassung für ihn ist, möglichst schnell nach der
Weitere Kostenlose Bücher