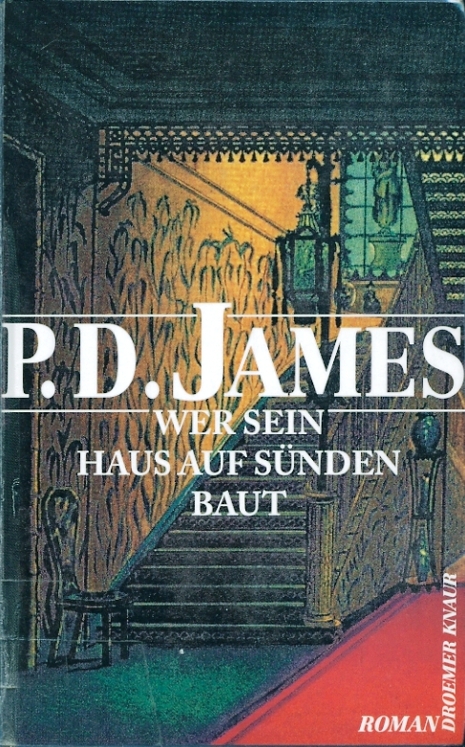![Adam Dalgliesh 09: Wer sein Haus auf Sünden baut]()
Adam Dalgliesh 09: Wer sein Haus auf Sünden baut
sehr schnell und so heftig zitiert, als mißbillige sie die ganze Zeremonie als Farce. Nach ihr war Jean-Philippe Etienne an der Reihe. Seit er sich im Jahr zuvor aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, war er nicht mehr in Innocent House gewesen. Zu der Gedenkfeier kam er mit eigenem Chauffeur von seinem abgelegenen Privatsitz an der Küste von Essex herüber, traf im letzten Moment erst ein und fuhr hinterher, ohne an dem im Sitzungssaal vorbereiteten kalten Imbiß teilzunehmen, gleich wieder ab. Aber sein Geleitwort war das längste, und er hatte es mit schleppender Stimme vorgetragen und sich dabei Halt suchend auf eine der schmiedeeisernen Kreuzblumen am Geländer gestützt. De Witt hatte ihr hinterher gesagt, das Zitat stamme aus den Selbstbetrachtungen des Marc Aurel, aber während des Vortrags hatte sich Blackie nur eine kurze Passage eingeprägt:
Des Menschenlebens Zeit nur ein Punkt,
sein Wesen in ewigem Fluß…
Mit einem Wort, alles:
im Bereich des Leibes ein Fluß,
in dem der Seele Traum und Rauch.
Das Leben ein Kampf und die Wanderschaft eines Fremdlings;
der Nachruhm Vergessenheit.
Gerard Etienne war als letzter an der Reihe. Er hatte seine Handvoll Asche von sich geschleudert, als gälte es, die Vergangenheit abzuschütteln, und dazu folgende Verse aus dem Prediger Salomo gesprochen:
Denn bei allen Lebendigen ist, was man wünscht: Hoffnung;
denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe.
Denn die Lebendigen wissen, daß sie sterben werden;
die Toten aber wissen nichts,
sie haben auch keinen Lohn mehr,
denn ihr Gedächtnis ist vergessen,
daß man sie nicht mehr liebt noch haßt noch neidet
und haben keinen Teil mehr auf der Welt von allem,
was unter der Sonne geschieht.
Danach hatte man sich schweigend zu kaltem Büfett und Wein hinauf in den Sitzungssaal begeben. Und um Punkt zwei Uhr war Gerard Etienne, ohne ein Wort zu sagen, durch Blackies Zimmer in das dahinterliegende Büro gegangen und hatte sich zum erstenmal in Henry Peverells Sessel gesetzt. Der Löwe war tot, und der lebende Hund hatte die Macht an sich gerissen.
7
Nach der Trauerfeier für Sonia Clements lehnte James de Witt dankend ab, als Frances ihn einlud, zu ihr und Gabriel ins Taxi zu steigen. Er wolle lieber ein Stück zu Fuß gehen, sagte er, und dann ab Golders Green die U-Bahn nehmen. Der Spaziergang vom Krematorium zum nächsten U-Bahnhof dauerte zwar länger als er geschätzt hatte, trotzdem war James froh, allein zu sein. Die Belegschaft von Peverell Press wurde von den Limousinen des Bestattungsinstituts zurückgefahren, und er wußte nicht, was schlimmer gewesen wäre – Frances ins unglücksstarre Gesicht zu sehen, ohne die leiseste Hoffnung, ihr Trost spenden zu können, oder sich mit einem Pulk junger Kollegen, denen selbst ein Begräbnis lieber gewesen war als ein öder Büronachmittag, in eine Nobelkarosse zu zwängen, wo seine Gegenwart die anderen daran gehindert hätte, nach dem erzwungenen Ernst in der Kapelle endlich ungeniert draufloszuschwatzen. Sogar Mandy Price, die neue Aushilfe, war dagewesen. Eigentlich brauchte ihn das aber nicht zu wundern, denn schließlich hatte sie, zusammen mit Claudia, die Leiche entdeckt.
Die Trauerfeier war eine trostlose Veranstaltung gewesen, und es war typisch für ihn, daß er die Schuld daran bei sich suchte, ja manchmal dachte er schon, daß es doch eine arg unbequeme Idiosynkrasie sei, ein so übertriebenes Schuldbewußtsein zu haben, ohne die passende Religion, die das Gewissen per Absolution wieder reinwäscht. Wie durch ein Wunder war im letzten Moment auch noch Miss Clements’ Schwester, die Nonne, aufgetaucht, hatte sich ganz hinten hingesetzt und war nach der Trauerfeier genauso eilig wieder verschwunden; kaum, daß sie sich die Zeit nahm, den Peverell-Mitarbeitern, die auf sie zukamen, um ihr mit gedämpfter Stimme zu kondolieren, die Hand zu geben. Zuvor hatte sie in einem Brief an Claudia den Verlag gebeten, das Begräbnis auszurichten, und dabei hätte Peverell sich wohl tatsächlich mehr engagieren sollen. Er hätte die Initiative ergreifen müssen, statt alles Claudia zu überlassen, die es im Endeffekt auf ihre Sekretärin abwälzte.
Es sollte, dachte de Witt, einen eigenen Ritus für Menschen ohne Religionszugehörigkeit geben. Wahrscheinlich gab es sogar längst etwas Vergleichbares, und wenn sie sich nur die Mühe gemacht hätten zu suchen, wären sie auch darauf gestoßen. So was könnte, überlegte er weiter, ein
Weitere Kostenlose Bücher