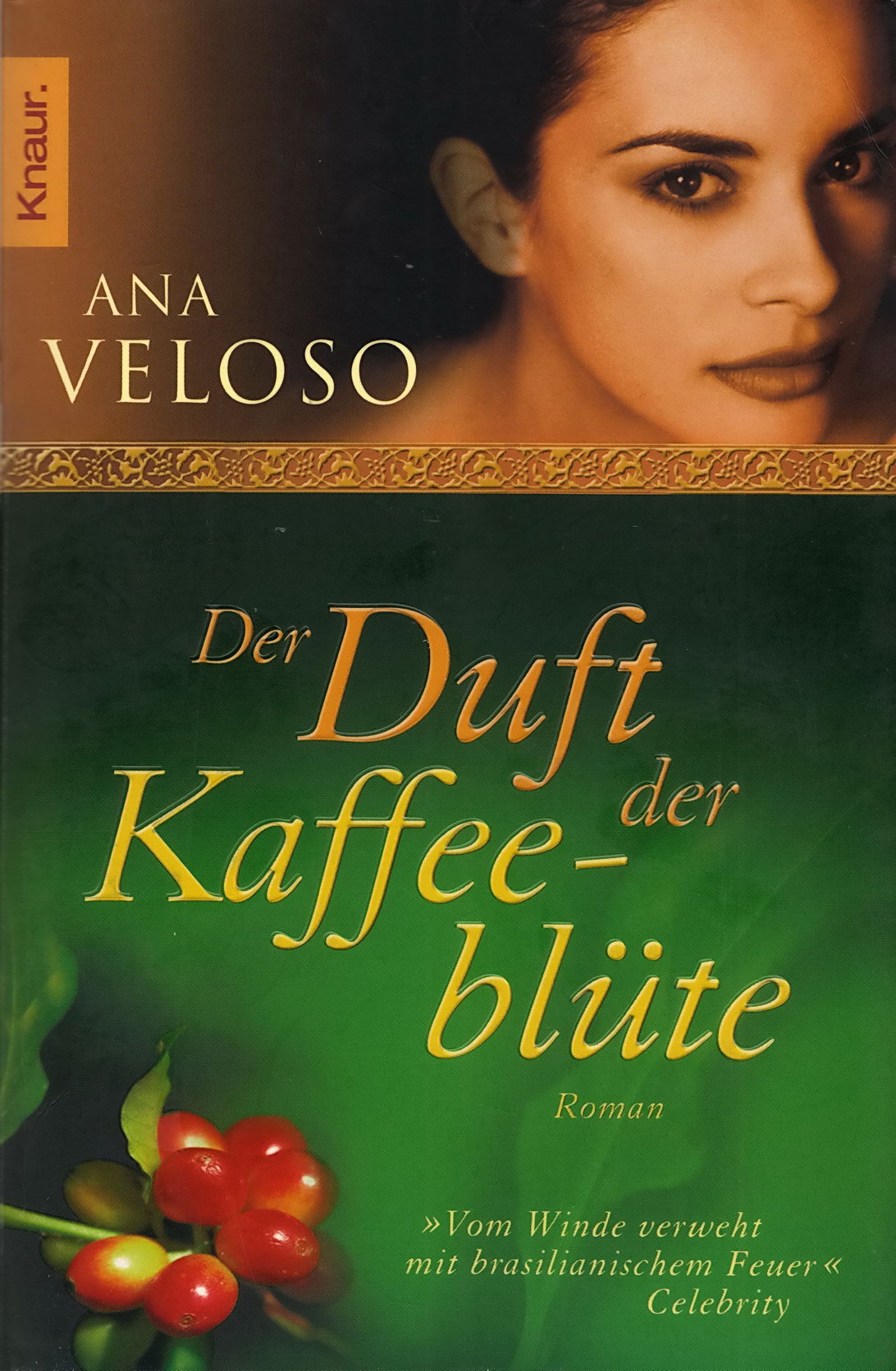![Ana Veloso]()
Ana Veloso
konnte man nur so
beschränkt sein? Félix war nicht nur stumm, sondern anscheinend auch blind!
Noch deutlicher konnte sie ja kaum werden, ohne sich der Gefahr auszusetzen, für
mannstoll gehalten zu werden. Es geschah Félix nur recht, dass er jetzt das törichte
Geschwätz von Bel über sich ergehen lassen musste. Und sie selber? Würde eben
mit Zeca tanzen, sobald der einträfe, was jeden Augenblick der Fall sein
musste. Er hatte noch einen dringenden Auftrag auszuführen, danach wollte er
kommen. Und bis dahin würde sie sich ein Schnäpschen gönnen und an der Theke
schamlos mit allen flirten, die ihr in die Quere kamen. Was kümmerte sie ihr
Ruf?
Als Félix sich endlich der lästigen Klette
entledigt hatte, war es zu spät. Er sah Fernanda und Zeca auf der Tanzfläche,
sah, wie fest er sie in seinen Armen hielt, wie nah sich ihre Gesichter waren,
wie Fernanda ab und zu den Kopf nach hinten warf und lachte. Ihm entgingen
nicht die verliebten Blicke Zecas und das Funkeln in den Augen Fernandas. Gelegentlich
sah sie verstohlen zu ihm herüber, und hätte Félix es nicht besser gewusst, hätte
er glauben können, sie wolle ihn irgendwie herausfordern.
Félix verließ das Fest als einer der Ersten. Mit
den Händen in den Hosentaschen schlenderte er die Straße entlang, die wie
ausgestorben unter dem silbrigen Licht des Vollmondes lag. Die Greise und die
Kleinkinder schliefen schon, alle anderen waren auf dem Fest. Ganz schwach war
noch die Musik des Akkordeons und der Fiedel zu hören, und Félix wurde von einer
sanften Melancholie ergriffen. Es war kein schlechtes Gefühl, diese Mischung
aus Wehmut und Romantik. In all seiner Traurigkeit genoss Félix in diesem
Moment auch das Alleinsein. Es war ein ganz neuartiges Erlebnis, durch das
menschenleere Viertel zu gehen, in dem er sonst nie auch nur eine Minute für
sich hatte. Seine Sinne waren geschärft, und er nahm Geräusche und Bewegungen
wahr, die ihm normalerweise entgangen wären. Eine Katze huschte über die
staubige Straße. In dem Feigenbaum raschelte es unheimlich. Aus einer Hütte
drang Babygeschrei, aus einer anderen der Geruch von verbrannten Bohnen.
Wahrscheinlich hatte Tia Nélida vergessen, den Topf vom Feuer zu nehmen, bevor
auch sie und ihr Mann zu dem Fest gegangen waren, wo sie trotz ihres Alters
ausschweifend tanzten. Félix betrat die Hütte ohne zu zögern, nahm den Topf von
der Kochstelle und löschte das Feuer. Aus der Fensteröffnung Richtung Hinterhof
sah er die Wäsche träge im Wind flattern, gespenstisch weiß in der mondhellen
Nacht. Ihm war, als sähe er ebenfalls einen menschlichen Schatten, der hastig
hinter der benachbarten Hütte verschwand. Oder war es nur ein Tier gewesen?
Aber nein, da war nichts, so angestrengt er auch zu der Stelle hinüberstarrte.
Félix verließ die armselige Behausung mit dem beklemmenden Gefühl, dass
irgendetwas nicht stimmte.
Er war hellwach und hatte noch keine Lust, sich
schlafen zu legen. Er beschloss, zu dem Bach zu gehen, der am Fuß des Hangs
entlangfloss. Tagsüber waren dort immer Frauen, die wuschen, Kinder, die Eimer mit
Wasser füllten und sie auf dem Kopf die steile Straße hinauftrugen, oder Männer,
die angelten. Der Bach war die Lebensader ihres Viertels, und obwohl er nur
mehr schlammiges, lehmgelbes Wasser führte, das an heißen Tagen erbärmlich
stank, waren einige Stellen der Uferböschung wie geschaffen dafür, sich dort
einfach niederzulassen und den Gedanken nachzuhängen. Doch gerade als Félix
sich auf einen Stein setzen und die Füße ins Wasser strecken wollte, bemerkte
er, dass er nicht allein war. Irgendwo hinter dem dichten Gras hatte es sich
offensichtlich ein Liebespaar bequem gemacht, dessen Seufzer ihn irritierten.
Ebenso lautlos, wie er gekommen war, ging Félix wieder davon. Die besinnliche
Stimmung, in der er gewesen war, hatte wieder einem niederschmetternden
Selbstmitleid Platz gemacht. Ihn wollte keine Frau küssen, jedenfalls
keine, die er ansprechend gefunden hätte. Mit ihm wollte ja nicht einmal jemand
befreundet sein, weder seine Kollegen, denen er zu schwarz war, noch seine
Nachbarn, denen er aufgrund seiner Beschäftigung zu weiß war. Er hatte weder
Eltern noch Geschwister noch irgendetwas, das auch nur annähernd den Namen »Heimat«
verdient hätte. Seine Vergangenheit hatte er am Tag seiner Flucht für immer
hinter sich lassen müssen, und seine Zukunft lag vor ihm wie ein nicht enden
wollender Tag im Kontor, düster, öde, monoton. Félix fühlte
Weitere Kostenlose Bücher