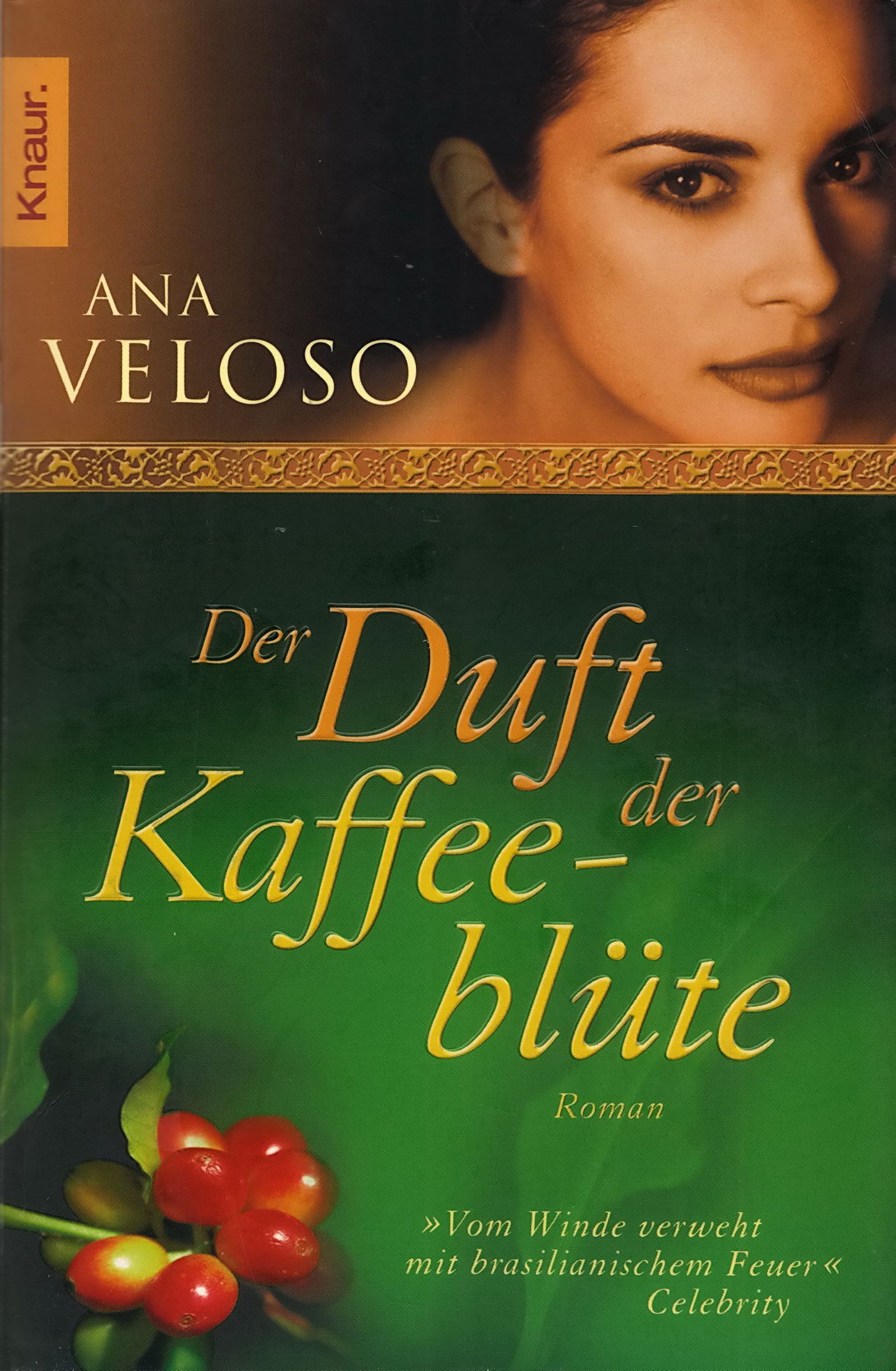![Ana Veloso]()
Ana Veloso
in dem Hohlraum, der sich zwischen
den Trägerbalken und dem Ziegeldach befand, versteckte. Viel Platz war dort
nicht, doch für Félix' kleine Kostbarkeiten reichte es. Er verstaute dort ein
paar Münzen, die ihm bei seinen Botengängen gelegentlich zugesteckt wurden, außerdem
einen skurril geformten Stein, den er einmal gefunden hatte, sowie den Reißzahn
eines Pumas, den er bei einer Wette gewonnen hatte. Und er bewahrte dort ein
kleines Lederbeutelchen auf, in dem sich ein goldenes Medaillon befand. Dieses
Schmuckstück war seine einzige Erinnerung an seine Mutter, die bei seiner
Geburt gestorben war. Sie hatte es von seinem Vater erhalten, dessen Identität
Félix nie klären konnte. Doch allein der Sachwert des Medaillons war so hoch,
dass es sich um einen höher gestellten Herrn gehandelt haben musste. Luiza
hatte es für ihn verwahrt, bis er zwölf Jahre alt wurde. »Hier, Jungchen, das
gehörte deiner Mutter. Du bist jetzt alt genug, selber drauf aufzupassen.«
Ehrfürchtig hatte Félix das Schmuckstück
genommen und es untersucht. José hatte ihm dann gezeigt, wie man das Medaillon öffnete.
Als der Deckel hochsprang, zuckte Félix kurz zurück. Als dann sein erster
Schreck verflogen war, betrachtete er das Medaillon genauer. Im Innern war auf
jeder Seite eine kleine, ovale Fotografie. Doch im Laufe der Jahre waren die
Bilder fleckig geworden. Es war kaum mehr etwas zu erkennen gewesen, außer dass
es sich um einen Mann, in Galauniform und mit einem ungewöhnlich geformten Säbel,
sowie eine dunkelhäutige Frau gehandelt haben musste. Seine Eltern.
José erhob sich ächzend von seinem Bett. Er
musste einfach nachsehen, Félix' Verschwinden würde ihm sonst keine Ruhe
lassen. Er stieg auf das Bett des Jungen und streckte sich, um an das Versteck
zu kommen. Nach einer Weile ertastete er ein Kästchen. Er holte es hervor und
setzte sich, um sich dessen Inhalt zu widmen. Der Stein war noch da, aber der
Zahn, die Münzen und das Medaillon waren weg. José, der sich nicht mehr daran
erinnern konnte, wann er das letzte Mal geweint hatte, bekam feuchte Augen.
VI
Der Boden war trocken und hart. Aus dem
festgetrampelten Lehm ragten unzählige Steine, deren spitze Kanten sich bei
jedem Schritt in die Fußsohlen bohrten. Nach zweitägigem Marsch auf dem
schmalen Weg waren Félix' Füße so wund, dass er seine Jacke zerreißen und die
Stofffetzen als notdürftigen Verband benutzen musste, um weitergehen zu können.
Beinahe sehnte er sich wieder zurück nach der Sumpflandschaft, die sie zuvor
durchquert hatten und die für die Füße weniger belastend gewesen war. Aber
nein: Der Sumpf hatte andere Höllenqualen mit sich gebracht, die er nie wieder
erleben wollte. Wie schnell man doch vergaß, wenn andere Übel sich in den
Vordergrund drängten. Fünf Tage waren sie jetzt unterwegs. Alle Knochen taten Félix
weh, und von der intensiven Sonne, an die seine hellbraune Haut nicht mehr gewöhnt
war, pellte sich seine Nase. Seine Lippen waren rissig. Eine zusätzliche Qual
bedeuteten die vielen juckenden Stiche – für die Insekten waren die
schwitzenden Körper ein Festmahl.
Noch schlechter als Félix erging es den Frauen,
die ihre Säuglinge und Kinder schleppen mussten, und den Alten, die nicht mehr
so gut auf den Beinen waren. Aber das waren nicht viele. Der Großteil der
insgesamt dreißig Personen, die den Zug bildeten, war jung und stark. Und ob
Alt oder Jung, Mann oder Frau, ein Wesenszug einte sie alle: Sie wollten der
Sklaverei entkommen – um jeden Preis. Wenn sie dafür tagelang durch unwegsames
Gelände marschieren und körperliche Schmerzen hinnehmen mussten, wenn sie dafür
den Rest ihres Lebens in Angst vor der Entdeckung leben sollten: Sie wollten es
auf sich nehmen.
Félix war, als er den berühmten Abolitionisten
León Castro mit unmissverständlichen Gebärden um Hilfe bei der Flucht gebeten
hatte, überzeugt gewesen, dass er alles würde ertragen können, wenn es nur der
Erlangung seiner Freiheit diente. Jetzt, nach den erschöpfenden Fußmärschen
durch das Hinterland der Provinz Rio de Janeiro und vier unerträglichen Nächten,
die er, dicht gedrängt mit den anderen Schwarzen, auf dem staubigen Boden von
Scheunen oder gar unter freiem Himmel verbracht hatte, war er sich dessen nicht
mehr so sicher. Warum hatte er den Komfort seiner kleinen Kammer, die er sich
mit dem Kutscher José teilte, aufgegeben? Wieso hatte er die Privilegien, die
er auf Boavista genoss, zu Gunsten dieser Reise in die
Weitere Kostenlose Bücher