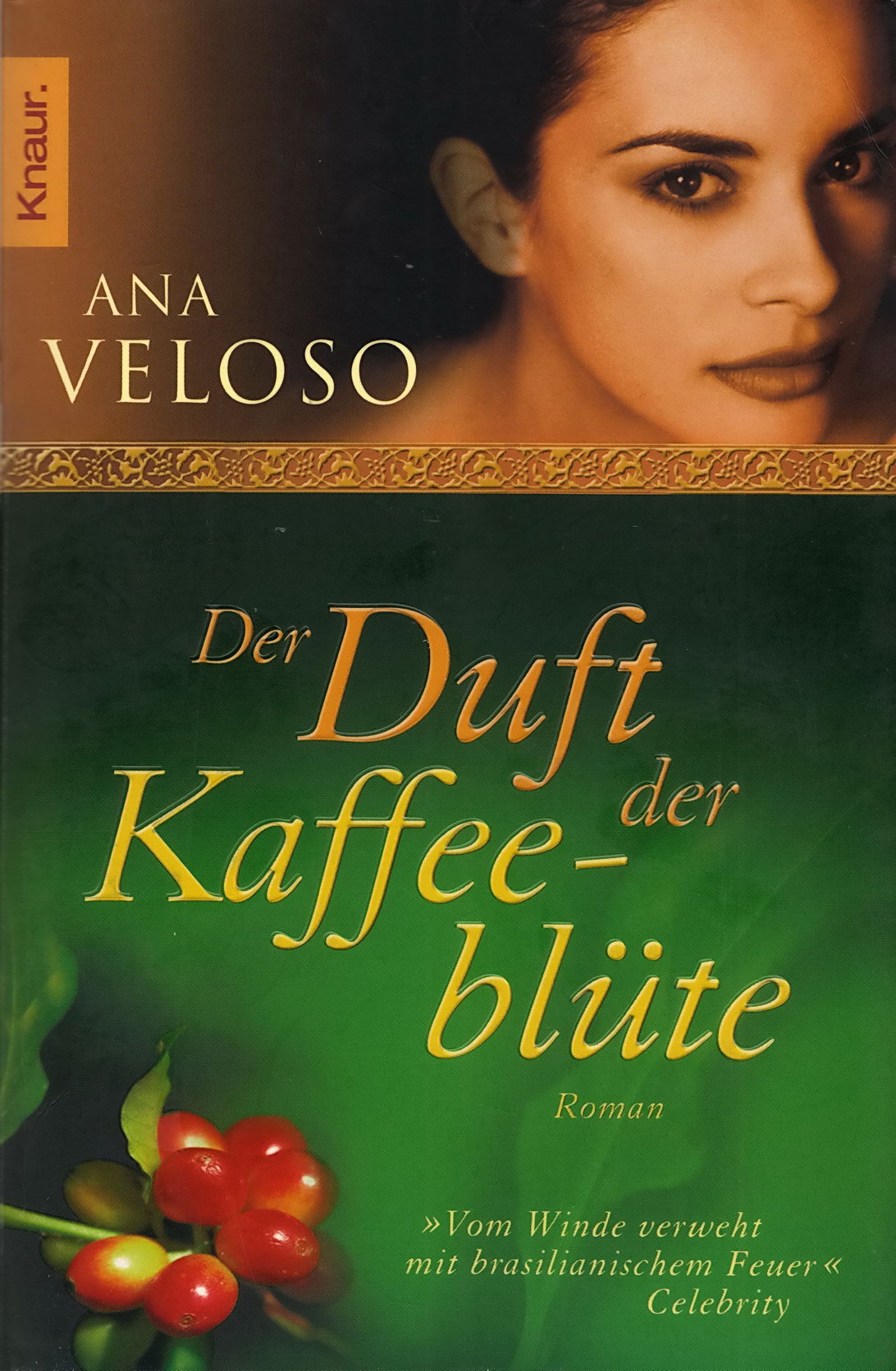![Ana Veloso]()
Ana Veloso
oder wenn ein großes
Fest gegeben wurde, spielte Dona Alma die Rolle der weltgewandten Dame, als die
sie sich längst nicht mehr fühlte.
Irgendwann im Lauf der vergangenen fünfundzwanzig
Jahre hatte sie sich von einer Aristokratin in eine Bäuerin verwandelt. Sie
hatte ihre Jugend verloren, ihre Leichtigkeit, ihre unbekümmerte Überzeugung,
dass sie zu Höherem berufen war. Und es war ganz schleichend passiert. Erst
diese Reise führte Dona Alma wieder vor Augen, wie sehr sie sich verändert
hatte. Früher hatte sie sich bei ähnlichen Gelegenheiten wie eine Königin gefühlt,
die sich dazu herablässt, die selbst gewählte Abgeschiedenheit ihres Schlosses
zu verlassen, um von ihrem Volk bejubelt zu werden. Heute kam sie sich eher vor
wie die verstoßene Königinmutter, die zu lange in einer Turmkammer eingesperrt
gewesen war und verlernt hatte, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Dona
Alma hatte Angst.
Vitória wunderte sich über das traurige Gesicht
ihrer Mutter, wagte aber nicht, nach der Ursache zu fragen. Und sie wollte sich
schon gar nicht davon den Spaß verderben lassen. Wochenlang hatte sie die
mustergültige Tochter gemimt, hatte sich in die Arbeit gestürzt, an ihrem
Klavierspiel gefeilt und Padre Paulo jede noch so kleine Verfehlung gebeichtet –
bis ihre Eltern ein Einsehen gehabt hatten: Jetzt, kurz vor Weihnachten, durfte
sie für ein paar Tage nach Rio fahren, um dort Geschenke zu kaufen. Sie hatte
all ihre Überzeugungskraft aufbringen müssen, um ihre Mutter zum Mitkommen zu
bewegen. Nicht dass Vitória auf die Gesellschaft von Dona Alma so großen Wert
gelegt hätte. Aber ohne deren Begleitung hätte sie überhaupt nicht reisen dürfen.
In dem Gewimmel am Bahnsteig hätten sie Pedro
beinahe übersehen.
»Mãe, Vita! Hier bin ich!« Pedro hüpfte hoch und
winkte mit seinem Hut. Sie verloren ihn wieder aus den Augen, aber er sprang
unbeirrt weiter hoch und rief dabei laut ihre Namen. Dona Alma fand, dass ihr
Sohn einen Narren aus sich machte, und war froh, als sie einander endlich begrüßen
konnten.
»Wie gut Sie aussehen, Mãe. Und Vita, du bist
tatsächlich noch hübscher geworden!«
»Ja, ja, ja«, sagte Dona Alma ungehalten, »aber
jetzt bring uns schnell fort von diesem grässlichen Ort.«
Vitória hatte es nicht so eilig, den Bahnhof zu
verlassen. Die Menschenmengen, das Gedränge und die bewundernden Blicke der Männer
gefielen ihr. Es war alles so herrlich städtisch.
Auf dem Vorplatz nahmen sie eine Mietdroschke.
Der Kutscher war unhöflich, und Vitória hatte den Verdacht, dass er absichtlich
über jede Unebenheit fuhr, um seine Fahrgäste durcheinanderzuschütteln. Aber
sogar das mochte sie. Städter waren nun einmal frecher als Landbewohner, das
gehörte irgendwie dazu. Sie holperten nach São Cristóvão, überholten dabei
zahlreiche Busse – Wagen, die etwa fünfzehn Personen Platz boten und von zwei
Pferden gezogen wurden –, fuhren vorbei an imposanten öffentlichen Gebäuden
sowie elegant gekleideten Menschen, die alle in Eile zu sein schienen. Vitória
sog jedes Detail, das sie aus dem Fenster beobachtete, in sich auf. Die
hektische Betriebsamkeit steckte sie an. Sie fühlte sich wach, lebendig und
unternehmungslustig wie lange nicht mehr. Das Haus in São Cristóvão lag in
einer engen, gepflasterten Sackgasse. Wie die Nachbarhäuser war es relativ
schmal und drei Stockwerke hoch. Es war in einem zarten Gelb gestrichen, und
vor den hohen Flügeltüren der oberen Etagen waren schmiedeeiserne Balkone
angebracht. Das Haus wirkte sehr gepflegt und hätte ebenso gut in einem
gehobenen Wohnviertel von Florenz, Nizza oder Lissabon stehen können. Einzig
die zwei Schwarzen, die in frisch gestärkten Schürzen und Hauben zur Begrüßung
der Familie an die Tür geeilt waren, gaben einen Hinweis darauf, dass man sich
nicht in Europa befand.
»Maria do Céu, bist du das? Himmel, wie du dich
verändert hast!« Maria do Céu knickste höflich. »Ja, Sinhazinha. Sie sehen aber
auch ganz anders aus, als ich Sie in Erinnerung habe.«
Beide mussten lachen. Dona Alma verstand nicht,
was daran so komisch sein sollte, und Maria do Céus Mutter, Maura, schämte sich
für die anmaßende Art ihrer Tochter. Vor zwei Jahren waren sie und Maria do Céu
gemeinsam nach São Cristóvão geschickt worden, um in dem Stadthaus der Familie
da Silva nach dem Rechten zu sehen. Maria do Céu war gerade dreizehn Jahre alt
gewesen, und inzwischen war aus dem plumpen Kind mit den zu langen Armen
Weitere Kostenlose Bücher