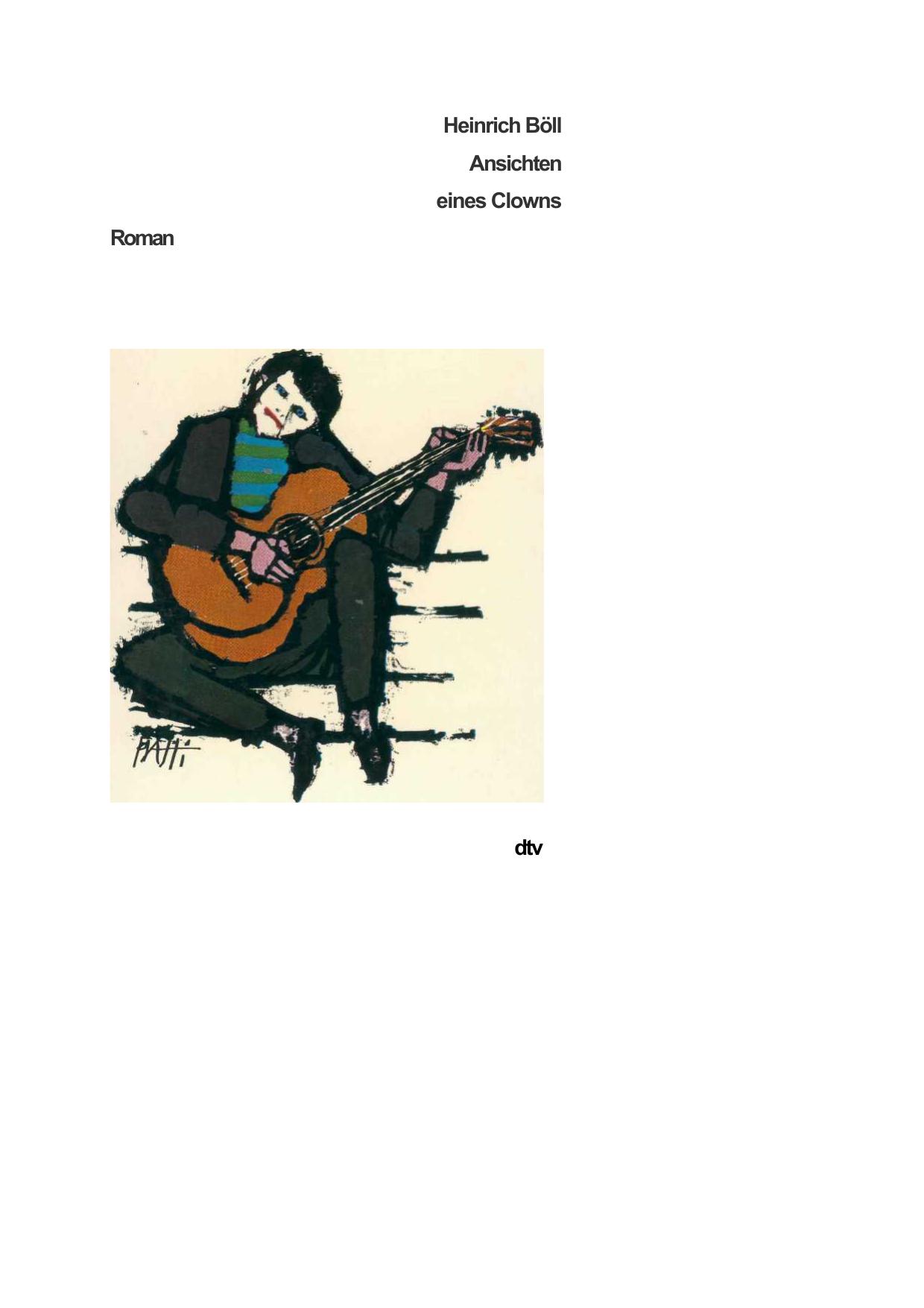![Ansichten eines Clowns]()
Ansichten eines Clowns
sich darüber, daß wir fast immer bis zehn oder elf im Bett blieben. Sie hatte nicht Phantasie genug, sich auszurechnen, daß wir auf diese Weise am leichtesten eine Mahlzeit und Strom fürs Heizöfchen sparten, und wußte nicht, daß ich meistens erst gegen zwölf in das Pfarr-sälchen zum Training gehen konnte, weil vormittags dort immer etwas los war:
Mütterberatung, Kommunionunterricht, Kochkurse oder Beratungsstunde einer
katholischen Siedlungsgenossenschaft. Wir wohnten nahe an der Kirche, an der
Heinrich Behlen Kaplan war, und er hatte mir dieses Sälchen mit Bühne als
Trainingsmöglichkeit besorgt, auch das Zimmer in der Pension. Damals waren viele Katholiken sehr nett zu uns. Die Frau, die im Pfarrheim den Kochlehrgang abhielt, gab uns immer zu essen, was übrig geblieben war, meistens nur Suppe und Pudding, manchmal auch Fleisch, und wenn Marie ihr beim Aufräumen half, steckte sie ihr gelegentlich ein Paket Butter zu oder eine Tüte Zucker. Sie blieb manchmal dort, wenn ich mit dem Training anfing, hielt sich den Bauch vor Lachen und kochte am
Nachmittag Kaffee. Auch als sie erfuhr, daß wir nicht verheiratet waren, blieb sie nett. Ich hatte den Eindruck, sie rechnete gar nicht damit, daß Künstler »richtig heiraten«. An manchen Tagen, wenn es kalt war, gingen wir schon früher hin. Marie nahm an dem Kochkurs teil, und ich saß in der Garderobe neben einem elektrischen Heizöfchen und las. Ich hörte durch die dünne Wand das Gekicher im Saal, dann
ernste Vorträge über Kalorien, Vitamine, Kalkulation, doch im ganzen schien mir das Unternehmen sehr munter zu sein. Wenn Mütterberatung war, durften wir nicht
erscheinen, bis alles vorbei war. Die junge Ärztin, die die Beratung abhielt, war sehr korrekt,
160
auf eine freundliche, aber bestimmte Art, und hatte eine fürchterliche Angst vor dem Staub, den ich aufwirbelte, wenn ich auf der Bühne herumhopste. Sie behauptete später, der Staub hinge noch am Tage darauf in der Luft und gefährde die Säuglinge, und sie setzte es durch, daß ich vierundzwanzig Stunden, bevor sie ihre Beratung abhielt, nicht die Bühne benutzen durfte. Heinrich Behlen bekam sogar Krach mit seinem Pfarrer deswegen, der gar nicht gewußt hatte, daß ich dort jeden Tag trainierte, und der Heinrich aufforderte, »die Nächstenliebe nicht zu weit zu treiben«. Manchmal ging ich auch mit Marie in die Kirche. Es war so schön warm dort, ich setzte mich immer über den Heizungskanal; es war auch vollkommen still, der Straßenlärm
draußen schien unendlich weit weg zu sein, und die Kirche war auf eine wohltuende Weise leer: nur sieben oder acht Menschen, und ich hatte einige Male das Gefühl, dazuzugehören zu dieser stillen traurigen Versammlung von Hinterbliebenen einer Sache, die in ihrer Ohnmacht großartig wirkte. Außer Marie und mir lauter alte Frauen. Und die unpathetische Art, mit der Heinrich Behlen zelebrierte, paßte so gut zu der dunklen, häßlichen Kirche. Einmal sprang ich sogar ein, als sein Meßdiener ausgefallen war, am Ende der Messe, wenn das Buch von rechts nach links getragen wird. Ich merkte einfach, daß Heinrich plötzlich unsicher wurde, den Rhythmus
verlor, und ich lief rasch hin, holte das Buch von der rechten Seite, kniete mich hin, als ich vor der Mitte des Altars war, und trug es nach links. Ich wäre mir unhöflich vorgekommen, hätte ich Heinrich nicht aus der Verlegenheit geholfen. Marie wurde knallrot, Heinrich lächelte. Wir kannten uns schon lange, er war im Internat Kapitän der Fußballmannschaft gewesen, älter als ich. Meistens warteten wir nach der Messe draußen vor der Sakristei auf Heinrich, er lud uns zum Frühstück ein, kaufte auf Kredit in einem Kramladen Eier, Schinken, Kaffee und Zigaretten, und er war immer
glücklich wie ein Kind, wenn seine Haushälterin krank war.
Ich dachte an all die Menschen, die uns geholfen hatten,
161
während sie zu Hause auf ihren Scheißmillionen herumhockten, mich verstoßen hatten und ihre moralischen Gründe genossen.
Mein Vater ging immer noch hinter seinem Sessel hin und her und bewegte
rechnend seine Lippen. Ich war drauf und dran, ihm zu sagen, ich verzichte auf sein Geld, aber irgendwie, so schien mir, hatte ich ein Recht darauf, von ihm etwas zu bekommen, und ich wollte mir mit einer einzigen Mark in der Tasche keinen
Heroismus erlauben, den ich später bereuen würde. Ich brauchte wirklich Geld,
dringend, und er hatte mir keinen Pfennig gegeben, seitdem ich von zu Hause weg
Weitere Kostenlose Bücher