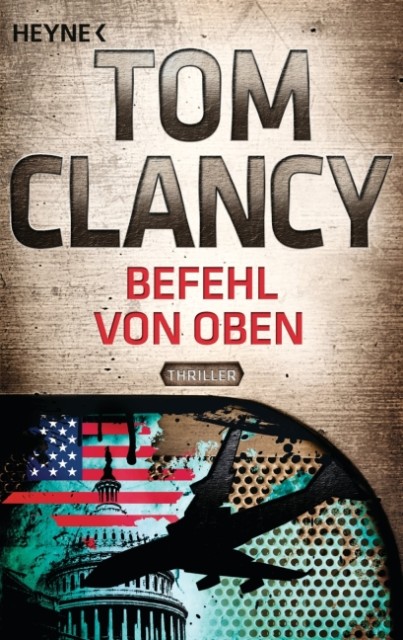![Befehl von oben]()
Befehl von oben
Plänen ergaben, welche man selbst in Gang gesetzt hatte.
*
Der schwerste Teil bestand darin, mit seinen Kollegen von der Weltgesundheitsorganisation klarzukommen. Das war nur möglich, weil die Lage soweit ganz gut erschien. Benedikt Mkusa, der ›Index-Patient‹ oder ›Patient null‹, es hing davon ab, welche Terminologie man bevorzugte, war tot und sein Leichnam vernichtet. Ein fünfzehnköpfiges Team durchstöberte die Nachbarschaft der Familie, ohne bislang etwas zu finden. Der kritische Zeitraum war noch nicht um – Ebola hat normalerweise eine Inkubationszeit von vier bis zehn Tagen, doch hatte es auch Extremfälle von knapp zwei und bis zu neunzehn Tagen gegeben –, aber der einzige weitere Fall befand sich vor seinen Augen. Wie sich herausstellte, war Mkusa angehender Naturforscher gewesen, der viel seiner Freizeit im umliegenden Busch verbracht hatte, und dort wurden jetzt Nagetiere, Fledermäuse und Affen gefangen in der Hoffnung, einen ›Wirt‹ oder Überträger des tödlichen Virus zu entdecken. Aufgrund des Familienstatus war der Index-Patient direkt ins Hospital gekommen.
Seine Eltern, wohlhabend und gebildet, hatten den Jungen von Medizinern behandeln lassen, statt sich selbst um ihn zu kümmern, und das hatte ihnen wahrscheinlich das eigene Leben gerettet. Jetzt warteten sie ängstlich die Inkubationsfrist ab. Jeden Tag wurde ihnen für die routinemäßigen IFT- und Antigentests Blut entnommen, doch die Tests konnten auch zu falschen Ergebnissen führen, wie ihnen ein grobbesaiteter Mediziner gedankenlos sagte. Desungeachtet erlaubte sich das WHO-Team die Hoffnung, daß dieser Ausbruch mit zwei Opfern zu Ende war, und war daher geneigt, dem zuzustimmen, was Dr. Moudi zu tun vorschlug.
Natürlich gab es auch Einwände. Die Ärzte Zaires wollten sie hier behandeln. Das war eine Sache der Anerkennung. In bezug auf Ebola hatten sie mehr Erfahrung – die zwar noch keinem genutzt hatte – als sonst jemand. Das WHO-Team wollte aus politischen Gründen die Kollegen nicht vor den Kopf stoßen. Es hatte ja einige unglückliche Vorfälle gegeben mit europäischem Hochmut, der die einheimischen Ärzte kränkte. Da waren beide Seiten ein wenig im Recht. Das Argument, das in diesem Fall zog, war die internationale Anerkennung Rousseaus in Paris als echter Koryphäe, begabter Wissenschaftler und ein erbarmungslos hingebungsvoller Kliniker, der einfach nicht hinnehmen wollte, daß man Viruserkrankungen nicht auch effektiv behandeln können sollte. In der Tradition von Pasteur vor ihm, war Rousseau fest entschlossen, diese Regel zu durchbrechen. Er hatte Ribavirin und Interferon als Mittel gegen Ebola versucht, ohne positives Ergebnis. Dieser theoretische Vorschlag war dramatisch, der Erfolg unwahrscheinlich, aber er hatte bei Versuchsreihen an Affen einen kleinen Lichtblick gebracht und er wollte ihn unter sorgsam kontrollierten Bedingungen nun an einem menschlichen Patienten ausprobieren. Die beabsichtigte Behandlungsmethode war zwar alles andere als zur klinischen Anwendung geeignet, man mußte aber irgendwo mal beginnen.
Der entscheidende Faktor war die Identität der Patientin. Viele vom WHO-Team kannten sie vom letzten Ebola-Ausbruch in Kikwit.
Schwester Jean Baptiste war dorthin geflogen, um die örtlichen Krankenschwestern zu unterweisen, und nicht weniger als andere ließen sich auch Ärzte rühren, wenn sie mit denen, die unter ihrer Obhut standen, persönlich bekannt waren. Schließlich erklärte man sich einverstanden, daß Dr. Moudi die Patientin transportieren könnte.
Technisch war der Transfer schon schwierig genug. Statt eines Krankenwagens benutzten sie einen Kleintransporter, denn der ließ sich danach leichter ausscheuern. Auf einer Plastikplane wurde die Patientin auf eine Bahre gehoben und zum Korridor hinausgeschoben. Der war zuvor von allen Leuten geräumt worden, und während Moudi und Schwester Maria Magdalena die Patientin zur Tür schoben, sprühte eine Gruppe von Technikern in Plastik-›Raumanzügen‹ den Fußboden, die Wände und selbst die Luft mit einem Desinfektionsmittel ab und erzeugten somit einen stinkenden chemischen Nebel, den die Prozession nach sich zog wie ein altes, qualmendes Auto.
Die Patientin war schwer sediert und gut fixiert, eingewickelt, damit kein virusverseuchtes Blut nach außen drang. Das Plastiklaken unter ihr war ebenfalls mit Desinfektionsmittel eingesprüht worden, so daß, falls doch etwas Blut durchsickerte, die Viren eine widrige
Weitere Kostenlose Bücher