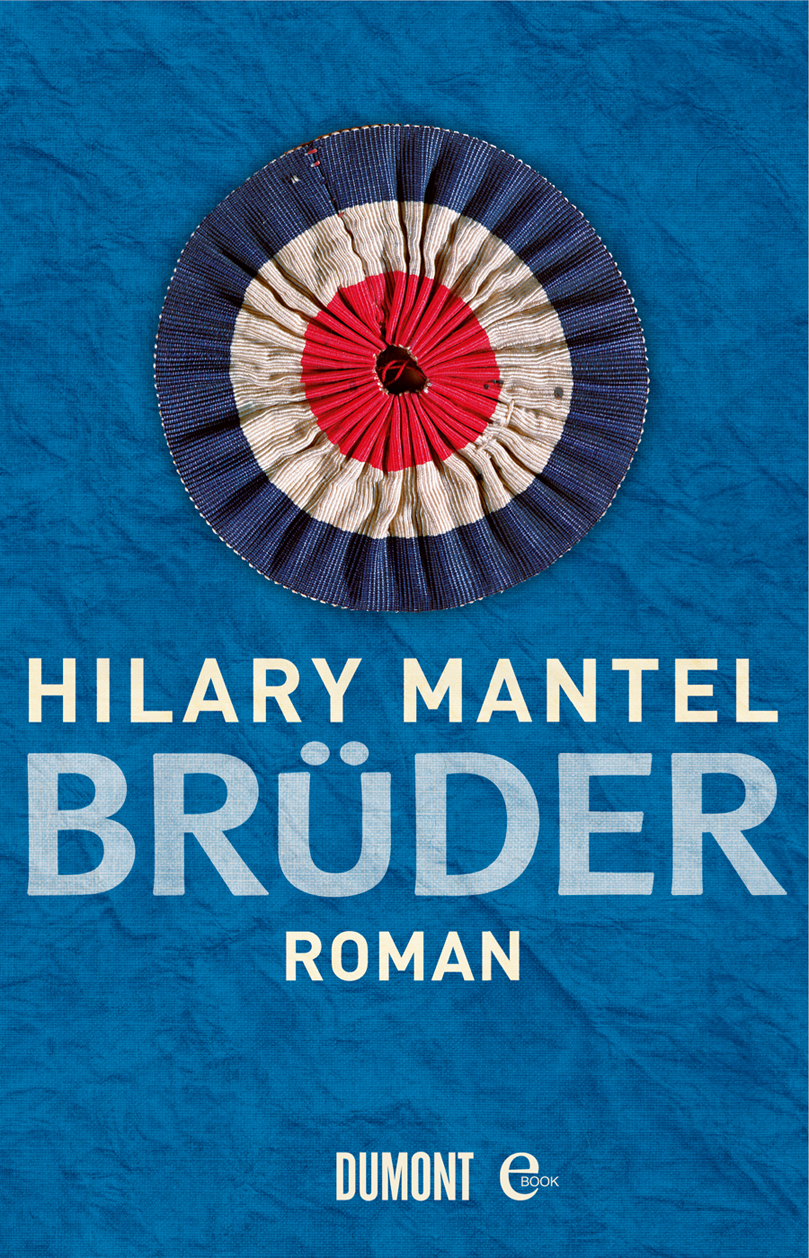![Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety]()
Brüder - Mantel, H: Brüder - A Place of Greater Safety
andere Erklärung gibt es nicht.«
»Er ist sehr nett zu uns, wissen Sie. Wie ein Bruder. Er verteidigt uns sogar gegen unseren Vater. Unser Vater ist ein Tyrann.«
»Das finden alle Kinder.« Eine faszinierende Frage kam ihm: Wie würde er mit seinem Kind umgehen, wenn es einen eigenen Willen entwickelte? Das Kind halbwüchsig, er selbst nicht mehr jung – es war etwas Unwirkliches an der Vorstellung. Was mag mein Vater gemacht haben, als meine Mutter mich geboren hat? Im Zweifel saß er an der Großen Enzyklopädie des Rechts . Im Zweifel hat er an seinem Register gebastelt, während meine Mutter sich in Qualen gewunden hat.
»Was denken Sie gerade?«, fragte sie.
Er konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Wie gut hoffte sie ihn kennenzulernen? Zumeist stellten die Frauen diese Frage nach dem Liebesakt, aber vermutlich mussten sie dafür erst einmal üben, selbst als Schulmädchen schon. »Ach, nichts«, sagte er. (Sie konnte sich gleich an die übliche Antwort gewöhnen.) Ihm war nicht ganz wohl in seiner Haut. »Elisabeth, weiß Ihre Mutter, dass Sie hier oben sind?«
»Nennen Sie mich doch Babette. Das ist mein Kosename.«
»Und, weiß sie es?«
»Keine Ahnung, ob sie es weiß oder nicht. Ich glaube, sie ist Brot kaufen gegangen.« Sie strich mit der Hand an ihrem Rock entlang, rutschte ein Stück auf dem Bett nach hinten. »Spielt es eine Rolle?«
»Die Leute fragen sich vielleicht, wo Sie stecken.«
»Um das herauszufinden, brauchen sie nur zu rufen.«
Eine Pause. Sie beobachtete ihn unverwandt. »Ihre Frau ist sehr schön«, sagte sie.
»Ja.«
»Hat es ihr gefallen, schwanger zu sein?«
»Anfangs ja, aber mit der Zeit hat sie es satt bekommen.«
»Und Sie wahrscheinlich auch.«
Er schloss die Augen. Er hätte schwören können, dass seine Ahnung nicht trog. Schnell öffnete er sie wieder. Er wollte sich sicher sein, dass sie blieb, wo sie war. »Ich glaube, ich sollte jetzt gehen«, sagte er.
»Aber Camille.« Sie riss die Augen weit auf. »Wenn Sie gehen, verpassen Sie vielleicht die Nachricht wegen des Kindes! Und das wollen Sie doch nicht, oder?«
»Nein. Nein. Aber wir sollten vielleicht nicht hier drin bleiben.«
»Wieso nicht?«
Weil du mich zu verführen versuchst, deshalb. Dass du dich nicht nackt ausziehst, ist schon alles. Und auch das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. »Das wissen Sie ganz genau«, sagte er.
»Aber man kann sich in Schlafzimmern doch auch unterhalten. Manche Leute feiern ganze Feste in Schlafzimmern. Oder halten Konferenzen ab.«
»Ja, natürlich.« Ich sollte schon längst weg sein.
»Haben Sie denn Angst, Sie könnten etwas Unrechtes tun? Gefalle ich Ihnen?«
Nein kann ich nicht sagen. Sonst fängt sie am Ende zu weinen an, wird fürs Leben verschüchtert, stirbt als alte Jungfer. Kein Nein also, aber es gibt Schlimmeres, was ich sehr wohl sagen kann. »Elisabeth, machen Sie das öfter?«
»Nein, ich komme nicht sehr oft hier herauf. Max arbeitet so viel.«
Sauber pariert. Eine kleine Bannerträgerin in der Armee rundwangiger Bürgersjungfrauen, die Sorte Mädchen, wegen der ich schon als Sechzehnjähriger in die Bredouille geraten bin. Und es wieder tun könnte.
»Ich will Sie nicht«, sagte er sanft.
»Darum geht es nicht.«
»Wie bitte?«
»Darum geht es nicht, habe ich gesagt.« Sie sprang vom Bett auf und kam auf ihn zu; ihre kleinen Füße in den Pantoffeln machten kein Geräusch. Ihre Hand legte sich leicht auf seine Schulter. »Sie sind hier, ich bin hier.« Sie langte an ihren Hinterkopf, zog die Nadeln aus ihrem Haar, schüttelte es. Mausbraune Locken, wallend jetzt. Und die Wangen gerötet … »Wollen Sie immer noch gehen?«, fragte sie. Denn dann würde sie hinter ihm die Treppe hinunterpoltern, an deren Fuß (er kannte diese furchtbaren Versammlungen) schon Eléonore und der Neffe und Maurice Duplay warten würden … Im Aufstehen erhaschte er einen Blick auf sein Gesicht im Spiegel und sah Wut darin, Schuldbewusstsein, Verwirrung. Sie ging rückwärts vor ihm her, bis sie an der Tür lehnte und zu ihm herauflachte, beileibe nicht mehr das unbedeutendste Mitglied der Familie.
»Das ist doch absurd«, sagte er. »Das ist unfasslich.«
Sie ließ ihn nicht aus den Augen. Sie erinnerte ihn an einen Wilderer, der frühmorgens seine Fallen abgeht.
»Ein romantisches Geplänkel reicht Ihnen nicht«, sagte er. »Sie wollen Blut sehen.«
»Ah«, sagte sie, »haben wir dann nicht etwas gemeinsam?«
Sie war klein, aber gedrungen;
Weitere Kostenlose Bücher