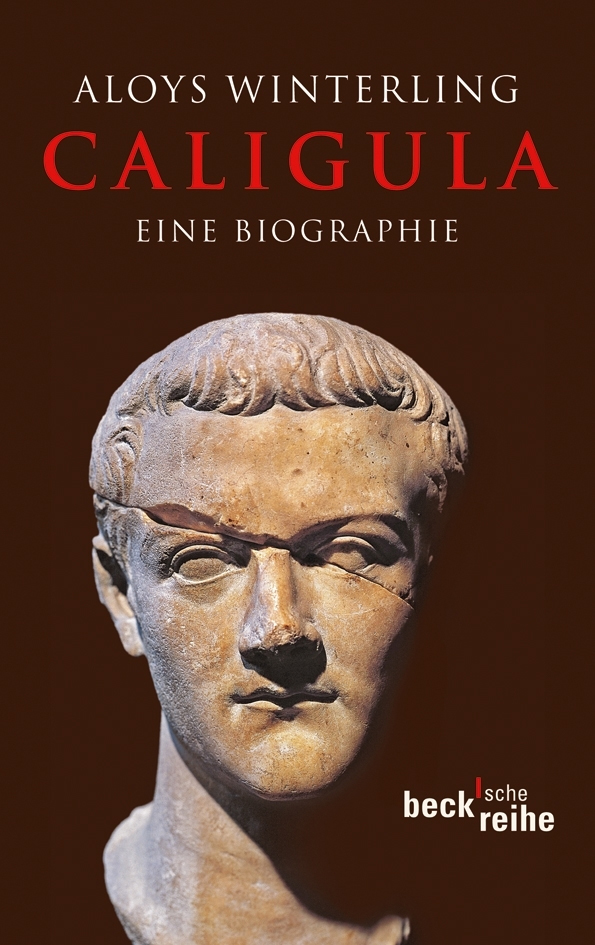![Caligula - Eine Biographie]()
Caligula - Eine Biographie
jüdischen – unter der Führung von Philo – und die nichtjüdischen Alexandriner jeweils Gesandtschaften an Caligula schickten. Das Problem verschärfte sich und weitete sich aus, als es vermutlich um die Mitte des Jahres 40 – die genaue Chronologie ist umstritten – auch in Judäa zu ähnlichen Auseinandersetzungen kam, in deren Verlauf ein Altar des Kaiserkultes in der Stadt Jamnia von Juden zerstört wurde. Damit war die Sache aus römischer Sicht zu einer Frage der Herrschaftsraison geworden, und erst in dieser Situation gab Caligula dem Statthalter Syriens, Publius Petronius, den Befehl, im Tempel von Jerusalem einen Kaiserkult einzurichten.
Daß das Ganze wenig mit göttlichen Ambitionen des Kaisers zu tun hatte, zeigt auch der weitere Verlauf des Konfliktes. Caligula ließ sich von dem jüdischen König Agrippa, der seit dem Lyonaufenthalt zu seinen engsten Vertrauten gehörte, zunächst umstimmen und wollte seinen Befehl zurücknehmen. Erst als er durch ein Schreiben des Petronius erfuhr, daß die Juden dem Statthalter gegenüber mit offenem Aufstand gedroht hatten, änderte er seine Position erneut. Die Angelegenheit war nun endgültig zu einer Frage der Durchsetzung der kaiserlichen Herrschaft in der Provinz geworden, und entsprechend befahl er, mit allen militärischen Mitteln den jüdischen Widerstand zu brechen und die Kaiserstatue aufzustellen.
Aufschlußreich ist nun aber vor allem, daß sich Philo, der ausführlich, und Iosephus, der nur an drei kurzen Stellen auf Caligulas Göttlichkeitswahn eingeht, in ihren Darstellungen des Kaisers in einen grundlegenden Widerspruch verwickeln.In Philos detaillierten Schilderungen seiner beiden Audienzen erscheint Caligula beim ersten Mal als freundlich und sachlich distanziert. Beim zweiten Mal, nach der Meldung des jüdischen Aufstands, wirft er der Gesandtschaft zwar vor, daß die Juden ihn nicht göttlich verehrten – das war ja das Problem –, er zeigt jedoch auch diesmal keinerlei abnorme Verhaltensweisen: Bei der Begrüßung verneigen sich die jüdischen Gesandten tief und ehrfürchtig, vom Zwang zur Proskynese berichtet Philo nichts. Caligula spottet über die jüdische Sitte, kein Schweinefleisch zu essen, und erntet damit zustimmendes Gelächter seiner Umgebung. Seine Hauptbeschäftigung besteht darin, Anweisungen für die Ausstattung seiner Wohngebäude in den Gärten des Maecenas und des Lamia auf dem Esquilin zu geben, wo die Audienz stattfindet. Er durchschreitet die Räume, befiehlt kostbare Verglasungen der Fenster und läßt Gemälde aufhängen, während ihm die jüdische und die alexandrinische Gegengesandtschaft treppauf treppab folgen müssen. Er verhält sich also wie ein ganz normaler römischer Aristokrat, der sich mit der Gestaltung seiner Häuser beschäftigt. Seine dilatorische Behandlung der beiden Gesandtschaften ist zwar für diese erniedrigend, von göttlichen Verhaltensattitüden oder sonstigem Wahnsinn zeigt Caligula in Philos eigenen Berichten jedoch keine Spur.
Ähnlich sieht es bei Iosephus aus. In der ausführlichen Schilderung der Ereignisse, die der Ermordung vorausgingen, zeigt der Kaiser wiederum völlig normale Verhaltensweisen. Er opfert dem vergöttlichten Augustus, zu dessen Ehren Spiele auf dem Palatin stattfanden, und sitzt anschließend im Theater von einigen vertrauten Senatoren umgeben, die ihn auch begleiten, als er das Theater verläßt. Er unterscheidet sich in seiner Kleidung und in seinem Äußeren offensichtlich in keiner Weise von seiner aristokratischen Begleitung, nichts wird erwähnt von irgendeinem besonderen Zeremoniell, kein Wort über Merkwürdigkeiten im kaiserlichen Benehmen. Philos und Iosephus’ Behauptung, Caligula habe sich in wahnsinniger Weise für einen Gott gehalten, findet also in ihren eigenen Schilderungen des Kaisers keinen Anhaltspunkt. Der Grund für die Feindseligkeit ihrer Darstellung liegt jedoch auf der Hand: Sein Befehl zur Durchsetzung des Kaiserkultes in Jerusalemhatte ihr Volk in höchste religiöse und politische Bedrängnis gebracht.
Der erste uns überlieferte römische Autor, der ähnliches behauptet, ist Sueton, hundert Jahre nach Caligulas Tod. Er schreibt in einer kurzen Passage der Vita Caligulas, dieser selbst habe eine göttliche Majestät
(divina maiestas)
für sich beansprucht und sich von anderen anbeten lassen. Und er schmückt dies mit Geschichten aus, die Zweifel am geistigen Zustand des Kaisers aufkommen lassen sollen: «Nachts lud er die
Weitere Kostenlose Bücher