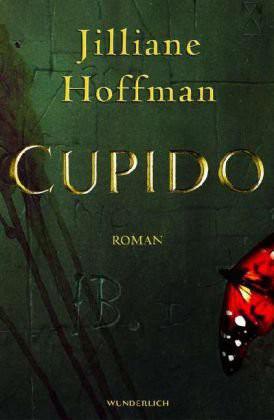![Cupido #1]()
Cupido #1
nach Hause. Es ist spät, und ich bin erschöpft.»
Er sah zu, wie sie nach der Aktentasche griff. «Hat der Antrag Chancen?»
«Nein. Nur heiße Luft. Sollte kein Problem sein.»
«Könnte ich die Kopie mal sehen?»
«Sie ist bei mir im Büro», log sie. Natürlich wusste sie, dass die Presse sich auf die Information stürzen würde, sobald der Antrag vor Gericht gestellt wurde und damit ein öffentliches Dokument war. Ihre Vergewaltigung würde in den Medien breitgewalzt werden, von jungen Journalisten durchgekaut, die versuchten, sich bei MSNBC einen Namen zu machen. C. J. würde alles wieder und wieder durchleben müssen, bis die Öffentlichkeit endlich das Interesse verlor. Und selbst wenn es nicht reichte, ihr den Fall zu entziehen, wäre Richter Chaskel nicht gerade erbaut, dass sie ihm nichts davon gesagt hatte. Außerdem fürchtete sie, dass Tigler sie von der Anklage abziehen und einen anderen Staatsanwalt einsetzen würde: einen, der keine derartigen Anschuldigungen als Ballast im Gepäck hatte. Ihr war klar, dass sie es Dominick sagen sollte, bevor die Sache an die Öffentlichkeit kam. Sie musste üben, alles abzustreiten, ohne alle zwei Sekunden zu heulen. Doch nicht heute Abend. Jetzt konnte sie einfach nicht mehr.
«Na gut. Ich begleite dich raus.» Er bedrängte sie nicht; er wusste, dann würde sie sich nur noch weiter zurückziehen. Also wechselte er das Thema. «Ich wollte Manny anrufen und ihn fragen, ob er mit mir essen geht. Ich habe mich den ganzen Nachmittag in den Clubs von Miami Beach herumgetrieben, und mitten am Tag ist das ziemlich deprimierend.» Er schloss die Zentrale hinter sich ab und winkte dem wachhabenden Beamten beim Hinausgehen zu.
Schweigend gingen sie zum Jeep und C. J. stieg ein. Heute würde es keinen so vertrauten Abschied geben wie neulich. «Danke, Dominick», war alles, was sie zustande brachte.
«Gute Nacht, C. J. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Jederzeit.»
Sie nickte und fuhr los.
Dominick drehte sich um und ging zu seinem Wagen. Im Dunkeln blieb er noch einen Moment sitzen und dachte über ihr Gespräch nach, darüber, dass C. J. schon wieder so merkwürdig auf die Erwähnung von Bill Bantlings Namen reagiert hatte. Er hinterließ eine Nachricht auf Mannys Anrufbeantworter, und dann hörte er seine Mailbox ab. Plötzlich klopfte es leise an die Scheibe.
Es war C. J. Er ließ das Fenster herunter.
«Himmel. Du solltest dich nicht so anschleichen. Vor allem nicht bei Leuten, die mit Pistolen im Halfter auf dunklen Parkplätzen sitzen. Ist alles in Ordnung?» Er sah sich nach ihrem Wagen um, der wahrscheinlich mit geöffneter Motorhaube mitten auf der Straße stand.
«Steht die Abendesseneinladung von neulich noch?», fragte C. J. mit einem erschöpften Lächeln. «Ich bin am Verhungern.»
54.
Es war acht Uhr abends, und Lourdes Rubio saß immer noch an dem Eichenschreibtisch in ihrem verlassenen Büro. Sie starrte ihr Diplom von der University of Miami an der Wand an und fragte sich, wie alles hatte so schief laufen können. Neben ihrem Diplom hingen zahlreiche Medaillen und Urkunden an der cremeweißen Wand, mit denen sie über die Jahre von verschiedenen juristischen Vereinigungen und Wohltätigkeitsorganisationen ausgezeichnet worden war.
An den Schwur, den sie als Anwältin hatte leisten müssen, erinnerte sie sich Wort für Wort – als sie vom alten Oberrichter Fifler vereidigt worden war, in einem grauenhaften lila Anzug mit riesigen Schulterpolstern, den sie sich extra für den Anlass gekauft hatte. Das war jetzt vierzehn Jahre her. Richter Fifler war gestorben, der lila Anzug aussortiert, und die Jahre waren irgendwie vorbeigeflogen.
Zum Entsetzen ihrer Mutter hatte Lourdes immer schon Strafverteidigerin werden wollen. Sie hatte tatsächlich die Verfassung hochhalten wollen, die Rechte der Unschuldigen schützen vor Big Brothers zudringlichen Augen und Ohren. Die ganzen idealistischen Flausen von der Uni hatte sie für bare Münze genommen. Dann war sie als Pflichtverteidigerin ins kalte Wasser gesprungen und hatte zusehen müssen, wie ihre Illusionen zerbröckelten.
Es gab keine Bleibe für die Obdachlosen, keine Hilfe für die Geisteskranken. Anwälte wollten Geld machen und handelten Vergleiche aus. Richter wollten sich das Arbeitspensum erleichtern. Ankläger wollten sich einen Namen machen. Für viele war das Rechtssystem einfach nur Mittel zum Zweck. Und trotzdem hatte Lourdes immer noch Strafverteidigerin sein wollen.
Bis
Weitere Kostenlose Bücher