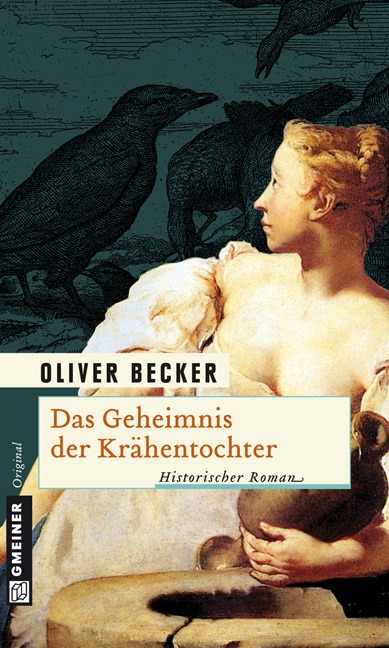![Das Geheimnis der Krähentochter]()
Das Geheimnis der Krähentochter
Zeit seines Lebens. Ihre Umgebung büßte bei solchen
Gedanken sogleich etwas von der überwältigenden Wirkung ein. Im
Unterbewusstsein hörte sie ein paar zögerliche Regentropfen ans Fenster
klopfen, und sie schlief ein. Doch nicht für lange. Donnergrollen, ein
krachender Wind und das Hämmern eines inzwischen wütenden, ungebändigten Regens
ließen sie immer wieder hochfahren, ebenso wie die beängstigend echt wirkenden
Träume, in denen Rosa plötzlich durch den Raum stürmte – »Krähentochter!«,
hörte Bernina die scharfe, zornerfüllte Stimme der Alten, begleitet vom Wüten
des Unwetters. »Du bist an allem schuld! Du allein!« Dann war auf einmal dieser
schreckliche Reiter in Schwarz da, der auf seinem Pferd saß, direkt vor Berninas
Bett, und auf sie hinabstarrte. Irgendwo auf dem langen Weg vom Petersthal-Hof
schien sie ihm entkommen zu sein. Und nun war es, als hätte er sie eingeholt.
Als sie frühmorgens erwachte, schmerzte ihr Kopf. Vom Lärm der
Nacht ebenso wie von der Stille, die sich mittlerweile ausgebreitet hatte und
dumpf und schwer vor dem großen Fenster lag. Ihr Mund war trocken, die Haut
ihrer Wangen spröde. Sie starrte an die Decke.
Ein Klopfen an der Tür. Ratlos blickte sie sich um – sie
wusste nicht, was sie sagen, was sie tun sollte. So fremd fühlte sie sich hier,
so einsam. Die Tür öffnete sich, und Bernina zog die Decke hoch bis zu ihrem
Kinn.
Ein Diener, den sie am Vorabend schon gesehen hatte, betrat den
Raum. Er nickte ihr mit gesenktem Blick zu, stellte ein silbernes Tablett auf
einem Tisch ab, rückte den Stuhl für sie zurecht und verschwand wieder, ohne
ein Wort, geräuschlos auf weichen Sohlen über den eleganten Holzboden
schwebend.
Langsam stand Bernina auf. Vorsichtig blickte sie auf das Tablett,
als könnte das Frühstück eine niederträchtige Falle sein. Sie sah Gebäck und
eine Kanne, die dezenten Teegeruch verströmte. Wie oft hatte sie in letzter
Zeit Hunger erleiden müssen, doch die Träume der zurückliegenden Nacht, ihre
Gedanken an Anselmo, das Ungewisse ihrer Situation, all das verschloss ihren
Magen. Nicht einmal einen winzigen Schluck Tee hätte sie herunterbekommen.
Sie wandte sich ab von dem Tisch, trat ans Fenster und zog den
Samtvorhang zurück. Ihr Blick wanderte über den Park und verlor sich im tristen
Himmel eines kalten, unfreundlichen Herbstmorgens.
Erst als wenig später Melchert Poppel voller Zurückhaltung seinen
Kopf und dann, als er sah, dass sie aufgestanden und angezogen war, seinen
gesamten Körper ins Zimmer schob, verspürte Bernina eine gewisse Erleichterung.
»War Ihre Nacht so wunderbar wie meine?«, erkundigte er sich mit
freundlicher Stimme.
»Ehrlich gesagt nicht.«
»Nicht gut geschlafen? Mitten im Paradies?« Ein tadelndes
Kopfschütteln.
»Nicht besonders.«
»Nun ja, umso besser, dass ich eine Nachricht habe, die Sie
vielleicht ein wenig aufmuntern könnte.« Er griff nach dem Gebäck auf dem Tisch
und biss herzhaft zu.
Berninas Haltung straffte sich sofort. »Was ist los?«
»Ich habe eben den Oberst untersucht. Sein Zustand hat sich nicht
verschlechtert. Beide Verletzungen, so beträchtlich sie auch sein mögen,
scheinen einigermaßen gut zu verheilen.« Poppels Augen suchten ihren
erwartungsvollen Blick. Er hörte auf zu kauen. »Ich berichtete ihm, was für
eine große Unterstützung Sie gewesen sind, nicht nur, was ihn betrifft, sondern
auch im Feld, wie viel Sie für zahlreiche seiner Männer getan haben.«
»Und? Wie äußerte sich der Oberst?«
»Er schien beeindruckt zu sein. Und er gab zu, dass Sie ihn
bereits um Hilfe für diesen bestimmten Mann ersuchten, er aber keine
Gelegenheit hatte, sich darum zu kümmern.«
»Bitte, Herr Poppel, kommen Sie zur Sache.«
»Nun ja, Falkenberg selbst wird zur Sache kommen. Mir gegenüber
hat er nicht viel gesagt. Aber er bittet Sie darum, ihn in seinen Gemächern
aufzusuchen. Und ich denke«, der Arzt verzog leicht den Mund, »das ist doch
schon mal erfreulich. Vielleicht betraut er einen fähigen Offizier mit der
Aufgabe, Ihren Anselmo endlich wiederzufinden.«
»Wir werden sehen«, meinte Bernina mit abwägendem Unterton.
Kurz darauf stand sie vor einem noch größeren Bett als jenem, das
sich in ihrem Zimmer befand. Darin saß Oberst Jakob von Falkenberg, die Beine
unter der Decke ausgestreckt, den Rücken von zwei prallen Kissen gestützt. Er
trug eine Art Nachtgewand, jedoch von feinerer Art als das Hemd, das in
Kraubach seinen Körper umhüllte.
Weitere Kostenlose Bücher