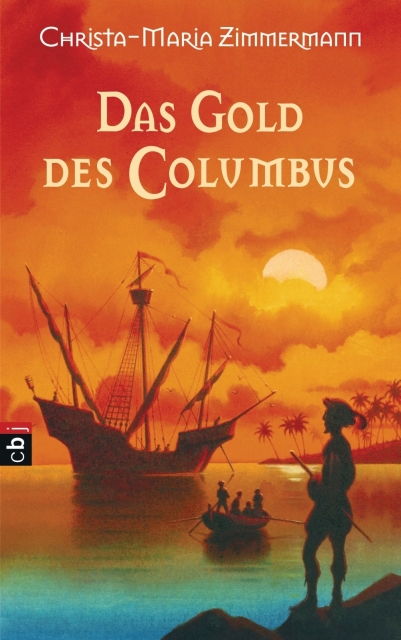![Das Gold des Columbus]()
Das Gold des Columbus
Der Vogel kollerte leise vor sich hin, wie ein blubbernder Wasserkessel.
»Knarrpp, knarrpp, knarrpp!« Pablo versuchte eine andere Tonfolge, den Anfang von Bendita la hora, das Estrella gesungen hatte.
Der Papagei beugte den Kopf vor und knabberte an Pablos Ohrläppchen. Der Junge musste kichern.
Der Indianer unterbrach seine drängenden Worte und sah die beiden erstaunt an.
»Es hermoso! Es bueno 21 !«, sagte Pablo.
Der Indianer lächelte auch ihn an. »Si! De hecho 22 .« Er konnte also doch ein bisschen Spanisch.
»Wie heißt er?«, fragte der Junge.
»Loro.« Es klang wie ein Lockruf.
»Loro«, wiederholte Pablo. »Loro bueno. Loro hermoso.«
»Loro«, knarzte der Papagei. »Loro.« Zumindest klang es so ähnlich.
Der Indianer betrachtete die beiden eine Zeit lang, dann sprach er wieder zu Diego Méndez.
»Er will dir den Papagei schenken, Junge. Er wird bald sterben. Er weiß, dass du für seinen Loro sorgen wirst.«
Ohne zu zögern, nickte Pablo. »Sehr gerne. Was frisst er?«
»Mahiz.« Der Indianer zeigte auf einen Sack in der Ecke der Kammer.
Pablo öffnete ihn. Dicke gelbe Körner schimmerten im dämmrigen Licht. Der Junge blickte den Escudero fragend an.
»Das ist Mais. Der Admiral hat die Pflanze von seiner ersten Reise mitgebracht und sie wird schon an vielen Orten in Andalusien angebaut. Du kannst ihn dir ohne Schwierigkeiten besorgen. Vorläufig hast du genug mit diesem Sack. Ein Papagei frisst nicht viel.«
Der Indianer wandte sich wieder an den Mann, der ihn verstand. Er schien ihm Anweisungen zu geben. Diego Méndez brachte ihm die Federkrone, die an einem Nagel an der Wand hing, und reichte ihm sein Messer. Der Kranke zog eine lange Feder aus der Krone. Sie schillerte in einem intensiven metallischen Blau. Mit dem Messer schnitt er sich eine Strähne seiner hüftlangen schwarzen Haare ab, flocht sie zu einem Zopf, schnürte damit die Feder zu einem Kreis und reichte ihn Diego Méndez.
Der nahm das Gebilde und schob es behutsam in eine Brusttasche. »Es soll alles geschehen, wie du es willst«, sagte er feierlich, als ob er einen Schwur spräche, und wiederholte die Worte in der fremden Sprache.
Der Indianer legte langsam seine Hand auf Diego Méndez’ Arm. »Tu hombre bueno 23 !« Dann sah er Pablo an. »Tu niño bueno 24 !«
Er legte sich zurück, zog die Decke bis zum Kinn hoch und schloss die Augen. Sein Gesicht nahm wieder die steinerne Unbeweglichkeit an.
Die beiden standen noch einige Augenblicke an dem ärmlichen Lager, dann gingen sie hinaus, Pablo mit dem Papagei auf der Schulter und dem Maissack auf der Hüfte.
»Er liegt im Sterben«, erklärte Diego Méndez dem Türsteher. Der nickte gleichmütig. »Hab ich mir gedacht. Er hat schon tagelang nichts mehr gegessen. Hoffentlich wird der Herr Graf jetzt endlich vernünftig und lässt die Finger von dem nutzlosen Pack.«
Sein Blick fiel auf Pablo, den der breite Rücken des Escuderos bisher verdeckt hatte. »He, Junge, was soll das heißen? Bild dir nicht ein, dass du den Papagei abschleppen kannst! Der ist sein Stück Geld wert und das will ich mir verdienen!«
Er streckte die Hand nach dem Vogel aus und riss sie mit einem Aufschrei zurück. Aus seinem Zeigefinger lief Blut.
»Du bissiger Teufel! Ich dreh dir den Hals um.«
»Stillgestanden!«, kommandierte Diego Méndez.
Der Türsteher nahm unwillkürlich Haltung an.
»Der Papagei ist ein Geschenk an den Jungen. Ich bin Diego Méndez de Segura und ich bin Zeuge. Also lass uns vorbei. Und kümmere dich um das Begräbnis.«
»Begräbnis? Dass ich nicht lache! Der Kerl wird irgendwo verscharrt«, höhnte der Türsteher hinter ihnen her. »Ein Begräbnis ist was für ehrliche Christen und nicht für gottlose Heiden.«
Die beiden beachteten ihn nicht. Eine Zeit lang gingen sie schweigend nebeneinander her.
»Er stammt aus Española. Er ist sehr unglücklich hier«, sagte Diego Méndez schließlich leise. »Er ist froh, dass er stirbt. Er hat sich nur am Leben gehalten, weil er auf einen Boten gewartet hat, der seine Feder und seine Haarsträhne in die Heimat bringt. Das habe ich ihm versprochen. Er heißt Mantamaguari.«
»Aber warum ist er unglücklich hier? Sevilla ist doch eine schöne Stadt.«
»Das findet er nicht. Er sagt, unsere Häuser stinken nach ranzigem Fett, unsere Gassen nach Kot und alle Menschen nach Schweiß. Er hat noch nie so viel Schmutz und Gestank erlebt. In seiner Heimat erfrischt man sich mehrmals täglich in Bächen, Flüssen und
Weitere Kostenlose Bücher