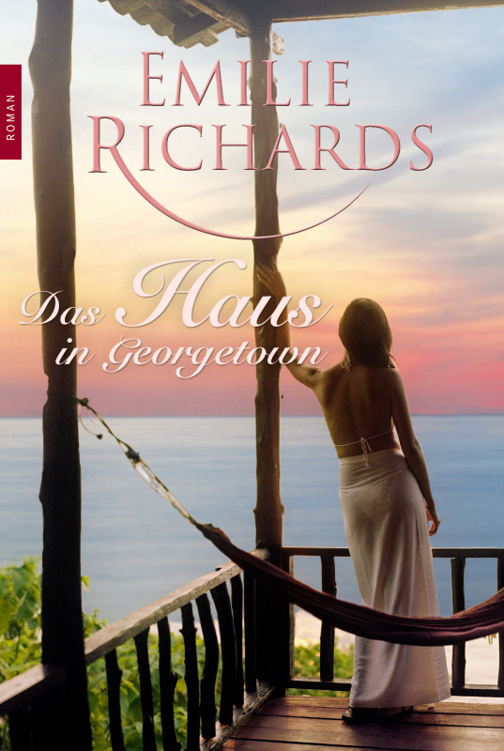![Das Haus in Georgetown]()
Das Haus in Georgetown
Lydia überhaupt eine beste Freundin gehabt hatte, war schwer vorstellbar. „Hat sie so ausgeschaut wie wir?“
Lydia hockte sich auf die Kante der Fensterbank und guckte wieder ihre Enkelin an. „Wie wir?“
„Wie meine Mutter und ich. Alle sagen, wir sehen dir ähnlich. Hat sie auch ausgesehen wie du?“
„Oh nein.“ Beinahe hätte Lydia gelächelt. Für einen Augenblick wirkte sie fast wie ein junges Mädchen. „Überhaupt nicht. Sie hatte rotes Haar. Hellrot, fast orange, sogar noch als ältere Frau. Sie hieß Violet, aber mein Großvater hat sie Karottenkopf genannt. Nicht sehr originell, fürchte ich, aber es war nett gemeint. Sie warso klein wie wir, aber kugelrund. Und sie hatte haufenweise Sommersprossen. Ich kann es dir auf Fotos zeigen.“
„Daher hat Alex also seine roten Haare.“
„Bestimmt.“
„Mir erzählt ja nie jemand was.“
Lydia zog eine Braue hoch. „Doch, gerade eben.“
„Ich will nicht nach Georgetown. Ich möchte nicht in dem Haus wohnen.“
„Ich weiß.“
„Mom tut so, als ob es große Klasse wäre. Als ob es egal wäre, dass ich es hasse.“
„Es ist ihr nicht egal. Das willst du im Augenblick nur nicht wahrhaben.“
„Wenn meine Gefühle ihr wichtig wären, würde sie eine andere Lösung finden.“
Zu Remys Verwunderung erklärte Lydia sie nicht für kindisch, sondern sie sagte: „Als ich das Haus in der Prospect Street als kleines Mädchen besucht habe, sah es da ganz anders aus.“ Sie stand wieder auf. Heute hatte sie Hummeln im Hintern wie ihr Enkelsohn. „Eines Tages, wenn du es hören möchtest, werde ich dir davon erzählen.“
Remy bezweifelte, dass dieser Tag je kommen würde.
„Vorerst liegt mir daran, dass du eines begreifst“, fuhr Lydia fort. „Deine Mutter hat in den letzten Monaten eine Menge durchgemacht. Ich will nicht, dass sie noch mehr verletzt wird. Also sei nett zu ihr und reiß dich zusammen.“
Remy starrte ihre Großmutter an. „Um sie machst du dir Sorgen, aber um mich nicht? Fein. Ich komme schon selbst zurecht.“
„Du brauchst deine Mutter noch, und sie braucht dich. Zieh dich nicht von ihr zurück.“
Bevor Remy etwas erwidern konnte, begann der Golden Retriever der Nachbarn zu heulen. Lydia beugte sich vor und schaute aus dem Fenster. „Der Umzugswagen ist da. Machen wir Schluss.“
Remy war nach Schreien zu Mute, aber sie hatte den Eindruck, dass niemand sie hören würde.
Als die Packer abgezogen waren, fühlte Faith sich wie ein Möbelstück, das die Männer für den Transport in Stücke zerlegt hatten. Als der Abend näher rückte, pochte ihr der Schädel, und vom Kistenschleppen und Auspacken der wichtigsten Dinge schmerzte der Rücken. Wäre sie allein gewesen, hätte sie ihr Bett gemacht und sich unter die Decke verkrochen.
Aber sie hatte zwei Kinder zu versorgen. „Wer will eine Pizza?“ Sie stand im Flur zwischen Alex’ und Remys Zimmern und versuchte fröhlich zu klingen – eine fast übermenschliche Anstrengung.
Alex steckte den Kopf zur Tür heraus. „Peperoni?“
„Was immer du willst. Wir feiern.“
„Remy hasst Peperoni.“
„Sie kann etwas anderes nehmen.“ Als ihre Tochter sich blicken ließ, erklärte ihr Faith, dass sie alle zusammen essen gehen würden – Widerstand sei zwecklos.
Sie warteten, bis die missmutige Remy ihre Turnschuhe angezogen hatte, schlossen ab und gingen in Richtung Wisconsin Avenue. Faith wusste nicht, wohin sie eigentlich liefen – Hauptsache fort von den Kartons und abblätternden Tapeten. Auf der Wisconsin hielten sie sich rechts und kamen zur M Street, wo es Dutzende von Restaurants gab. Dort entschied sich Faith für ein Bistro, das weniger nach Bar aussah als die meisten anderen, und bestellte für Remy eine vegetarische Pizza, für Alex eine Peperoni-Pizza undfür sich selbst nur einen Salat. Zu erschöpft zum Essen, stocherte sie darin herum.
Seit sie aus dem Haus waren, hatte Remy keinen Ton gesagt, und Alex hatten die heutigen Ereignisse so zugesetzt, dass er mitten in seinem zweiten Pizzastück verstummte. Auch Faith wusste nicht, worüber sie reden sollte. Sie wollte mit ihnen über Davids Besuch sprechen und über die Notwendigkeit einer Versöhnung. Aber im Augenblick hatte sie das Gefühl, ihrem Mann nie verzeihen zu können. Sie war mit ihren Kräften am Ende und nicht in der Lage, sich auch noch um den Mann, der das alles verursacht hatte, Gedanken zu machen.
Anstatt mit ihnen zu reden, beobachtete sie ihre Kinder. Das Bistro war billig
Weitere Kostenlose Bücher