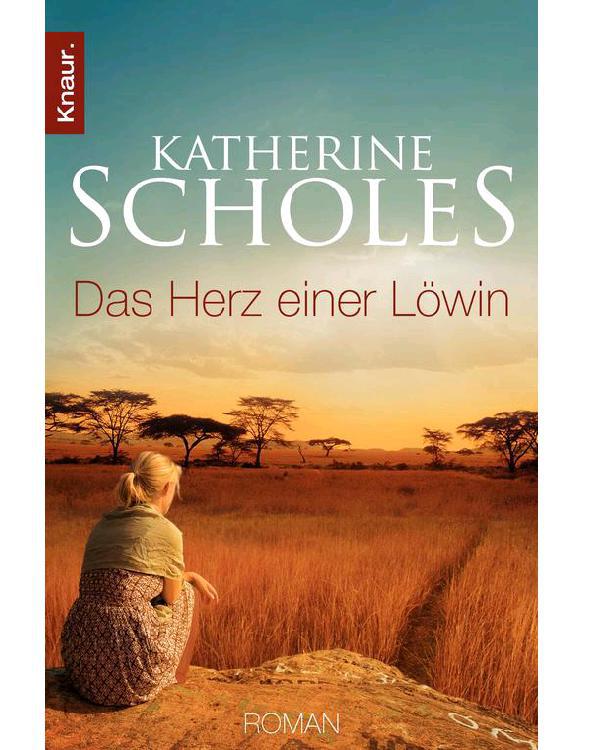![Das Herz einer Löwin: Roman (German Edition)]()
Das Herz einer Löwin: Roman (German Edition)
das ihre Mutter in Gang gesetzt hatte, hatte sie über all die Jahre hinweg verfolgt wie ein Fluch.
Erschrocken ließ Emma den Vorhang los. Es war doch ein Sakrileg, so etwas zu denken, vor allem hier an diesem Ort, wo Susan gelebt hatte. Sie trat zu ein paar verblichenen Postern, die an der Wand neben der Tür hingen. Eines war eine Dosierungstabelle für ein veterinärmedizinisches Medikament. Das andere stammte von einer Gesundheitskampagne über Impfungen. Es war die Zeichnung eines kleinen Kindes, das sich hinter einem traditionellen Massai-Schild vor Speeren schützte. An den Speeren stand auf Englisch und Swahili: »Polio«, »Tetanus« und »Typhus«.
»Unser Traum ist es, dass dort eines Tages auch Olambo-Fieber steht.«
Emma zuckte zusammen, als sie Daniels Stimme hörte; sie hatte ihn auf seinen nackten Füßen nicht kommen hören. Er trat neben sie. Sie roch Motoröl, vermischt mit etwas anderem, das sie an Honig erinnerte.
Emma nickte. Eine Impfung war die Traumlösung für jeden Virus, weil antivirale Medikamente selten effektiv waren, selbst wenn sich jemand die Mühe machte, sie zu entwickeln.
»Aber es ist zu teuer«, fuhr Daniel fort.
Emma nickte wieder. Es war wohl unmöglich, die notwendigen Mittel für einen genetisch hergestellten Impfstoff gegen eine Seuche, die bisher nur in einem kleinen Teil Ostafrikas vorkam, zusammenzubekommen. Wenn ein tödlicher Virus die Bevölkerung von New York oder Sydney bedrohen würde, dann wäre es etwas anderes. »Sie können sich eigentlich nur darauf konzentrieren, die Übertragung zu kontrollieren und so die Ausbruchsgefahr relativ gering zu halten«, erwiderte sie.
»Das haben wir auch vor«, stimmte Daniel ihr zu. »Aber wie gesagt, wir finden nicht heraus, wo sich der Virus versteckt. Wir suchen und suchen, und es gibt einfach kein Anzeichen dafür.« Es hörte sich so an, als redete er von einem exotischen Tier, das besonders schwierig aufzustöbern war.
»Wie sammeln und bearbeiten Sie Ihre Proben?«, fragte Emma.
»Ich zeige es Ihnen.« Daniel ging mit ihr im Labor herum, zeigte ihr die Fallen, die Ndugu und er benutzten, und beschrieb ihr, wie sie den Tieren Blut abnahmen und es dann auf Antikörper gegen Olambo testeten. Er zeigte ihr auch den alten handbetriebenen Separator, den er und Ndugu benutzt hatten, bevor sie sich einen mit Kerosin betriebenen Kühlschrank leisten konnten. »Jetzt lassen wir die Röhrchen über Nacht einfach im Kühlschrank«, erklärte er Emma. »Die Blutzellen verklumpen und sinken herunter – und am Morgen brauchen wir das Serum nur noch abzugießen.«
Wie sehr er sich über etwas so Grundlegendes wie einen Kühlschrank freuen konnte! Emma dachte an die Ausstattung im Institut. Ohne die besten Geräte und genügend Mitarbeiter würden Leute wie sie noch nicht einmal anfangen zu arbeiten.
»Fällt Ihnen etwas auf, was nicht richtig ist?«, fragte Daniel. »Sollten wir irgendetwas anders machen?«
Emma schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe an Ihren Methoden nichts auszusetzen.«
Daniel wirkte niedergeschlagen, so als ob es ihm lieber gewesen wäre, wenn sie irgendetwas falsch gefunden hätte, statt sich damit herumzuschlagen, dass seine Arbeit ohne Ergebnis blieb.
Emma suchte nach tröstlichen Worten. »Der Ausgangspunkt des Lassa-Fiebers ist auch nie gefunden worden, und daran haben ganze Mannschaften gearbeitet. Es ist also kein Wunder, dass Sie bei Olambo noch keinen Erfolg gehabt haben.«
»Aber ich habe nicht vor, aufzugeben«, erklärte Daniel fest. »Wir können noch eines versuchen. Wir haben noch nicht alle großen Säugetiere getestet – Büffel, Wildhunde, Löwen, Elefanten. Ihnen können wir nur Blut abnehmen, wenn wir auf sie schießen, mit Betäubungsmitteln oder mit Kugeln. Betäubungsgewehre haben wir nicht. Außerdem reagieren diese wilden Tiere unberechenbar auf Narkosemittel. Es ist gefährlich für sie. Aber ich würde die Tiere nicht gerne töten, nur um eine Blutprobe nehmen zu können. Das könnte ich nicht. Also suche ich nach einem Weg, wie ich weitermachen kann. In der Zwischenzeit erledigen wir unsere Arbeit.«
Mitgefühl für ihn stieg in Emma auf. Er beklagte sich nicht über seinen Mangel an Ressourcen und liebte seine Arbeit sehr. Sie wünschte, sie könnte etwas tun. »In zehn Tagen bin ich wieder in Melbourne«, sagte sie. »Ich werde versuchen, eine Organisation zu finden, die Sie unterstützen kann.«
»Danke«, sagte Daniel. »Ich wäre Ihnen wirklich sehr
Weitere Kostenlose Bücher