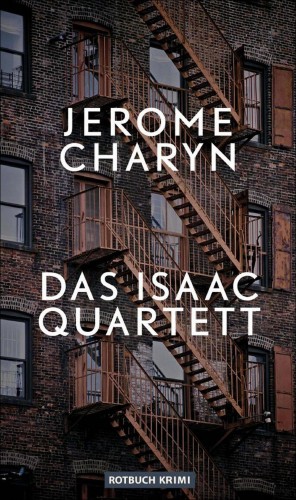![Das Isaac-Quartett]()
Das Isaac-Quartett
und Portugiesisch. Meine Hoffnung und mein Gebet gehen dahin, dass die Spione des heutigen Nachmittags nicht herausfinden werden, wo ich wohne, und dass nur deine Engel, Herr, die Engel Adonais, mir in mein sicheres, dunkles Heim folgen.«
Als Teil seiner Verpflichtungen gegenüber dem Familienzweig in der Bronx hatte Mordeckay Jerónimo geerbt. Nachdem er das Baby am Flughafen abgeholt hatte (für die Guzmanns, aber auch nur für die Guzmanns, verließ Mordeckay seine Colonia, und auch das nur in einem Wagen mit Chauffeur und Sonnenblenden vor den Scheiben), brachte Mordeckay Jerónimo zu Belisario Dominquez. Doch das Baby konnte nicht stillsitzen. Daher musste Mordeckay ihn bis zum Zócalo und den gedrängten Librerías (Buchhandlungen) am Alameda-Park begleiten. Mit Jerónimos unglaublichem Tempo konnte er nicht Schritt halten, und wenn er sein Piso (seine Wohnung) mit einer betriebsfähigen Lunge erreichen wollte, war er gezwungen, sich auf eine Parkbank zu setzen und Luft zwischen seine Rippen zu pumpen. Dennoch erhielt er seine Loyalität aufrecht und schwieg mit einer Feinfühligkeit, die selbst unter den Chuetas in diesem Maße selten war. Nie fragte er seine Cousins, warum sie ihm einen Subnormalen aufgebürdet hatten, der einen Karamellklumpen im Mund brauchte, um zu überleben. Dabei spielte es keine Rolle, dass auch er den Jungen liebte. Er hätte ihn mit ebensolcher inbrünstiger Hingabe umgeben, wenn er sich vor diesen klebrigen Karamellbacken geekelt hätte.
Nur einmal hatte er sich in die Angelegenheit seiner Cousins gemischt. Das war vor achtzehn Jahren gewesen, als er auf Moisés Guzmanns Ersuchen in die Bronx gekommen war. Mordeckay fuhr mit dem Schiff. Sein Frachter brachte ihn über den Wendekreis des Krebses in den Golf von Mexiko, um die Key-Inseln zum holprigen Atlantik bis zum Hafen von New York. Die Guzmanns hatten ihn in dicken Pullovern und mit Ohrenschützern an der Anlegestelle abgeholt; Eiszapfen bildeten sich an ihren mit Sirup befleckten Hosen. Mordeckay trug ein Madrashemd, das dem mexikanischen Winter angemessen war. Sie hüllten ihn in Pullover und Ohrenschützer und geleiteten ihn mit einem Nachbarn, Boris Telfin, am Steuer des Familienwagens, einer 49er Chrysler-Limousine, aus Manhattan heraus (keiner der Guzmanns wollte das Fahren lernen). Mordeckay bewunderte die Geräumigkeit des Fahrzeugs.
»Moisés«, rief er in einer Mischung aus Spanisch und Portugiesisch, damit Guzmanns Söhne nicht jedes Wort verstanden, »fahren wir zu deiner Judería?. «
Papa lachte. Er erzählte Mordeckay, dass die Judería (das Judenviertel) der Bronx von einem Ende des Stadtteils zum anderen reichte.
Mordeckay war ob dieses Wunders vom Donner gerührt. Noch nie hatte er von einer Judería gehört, die so groß war, dass sie ganze Stadtteile verschlang; nicht einmal die große Judería von Lissabon (vor der Vertreibung der Juden) hätte es mit der Bronx aufnehmen können. Er war betäubt vor Erstaunen, bis ihn die fünf Guzmanns vom Chrysler in den Süßwarenladen verfrachteten. Sie stellten ihn als »Primo Mordeckay«, ihren mexikanischen Cousin, vor. Er hatte kein eigenes Lager und zog im Hinterzimmer des Ladens von Bett zu Bett, schlief einen Tag bei Jerónimo und am nächsten bei Topal. Man gab ihm eine lange Unterhose, eine wurmstichige Zahnbürste (die früher Alejandro gehört hatte) und einen Topf für seine Fäkalien für den Fall, dass die Toilette besetzt sein sollte (Jerónimo hatte auf dem gemeinschaftlichen Klositz der Guzmanns seine schönsten Träume).
Mordeckay und Papa lebten nicht nach dem exakt gleichen Kalender, und als Mordeckay im Mittwinter verkündete, er müsse sein Pão santo backen (sein heiliges Brot), brauste Papa auf. »Cousin, das ist nicht die rechte Zeit für Pascua. Warte auf uns. Wir backen im Juli Brot.«
Primo Mordeckay widersetzte sich, und Papa musste für die spröden Fladen Pão santo (Brotscheiben, die nicht aufgingen) auf seinen Ofen verzichten; das Brot lag bitter auf seiner Zunge und verursachte ihm Sodbrennen. Nichtsdestoweniger zwang er seine Söhne, Mordeckays Brot zu verdauen. Doch er wollte nicht zulassen, dass Mordeckay ihn mit dem Tag der Heiligen Esther schikanierte und weigerte sich, ihn zu begehen.
»Cousin, hier werden keine Frauen verehrt.«
»Moisés«, sagte der Cousin, und sein Gesicht lief schamrot an, »nicht einmal die Limios« – Christen reinsten Blutes – »würden Santa Esthers Tugenden in Zweifel ziehen. Ich kann nicht
Weitere Kostenlose Bücher