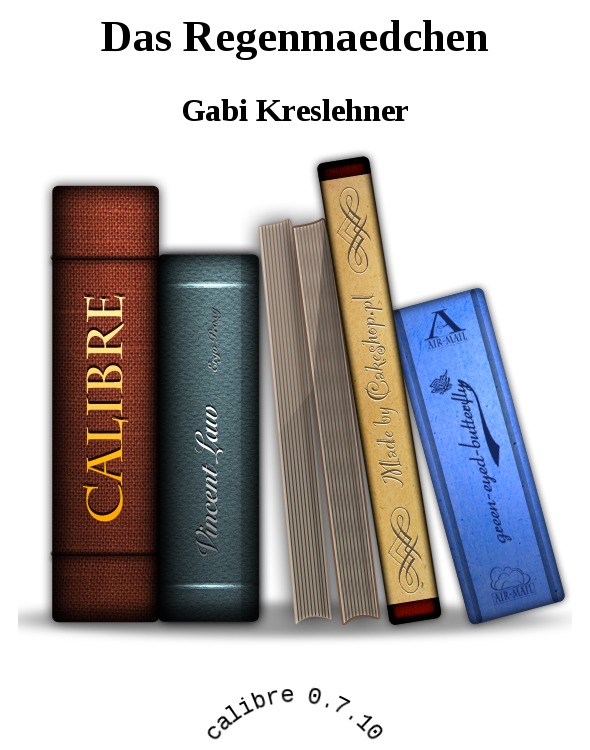![Das Regenmaedchen]()
Das Regenmaedchen
ganztags
im Büro zu arbeiten. Also schickten sie das Kind nach der Schule zu den
Großeltern. Dort konnte es seine Schularbeiten machen. Bekam Essen. Sie
spielten mit ihm, machten Ausflüge. Es war für alle eine große Erleichterung.
Aber Marie begann sich zu verändern. Wurde scheu. Weinte
in der Nacht. Hatte Angst. Lachte nicht mehr.
Die Frau dachte, vielleicht werden Kinder so, wenn sie
wachsen und älter werden. Sie dachte, vielleicht bilde ich mir alles ein. Und
dann verdrängte sie es. Die Auftragslage war gut. Es gab viel zu tun, sie hatte
wenig Zeit. War abends müde.
Dann kam die Schwägerin zu Besuch, und als sie hörte, dass
Marie bei ihrem Großvater, jeden Tag ...
Sie ging hin, tobte. Man hörte das Geschrei bis auf die
Straße.
Dann nahm sie Marie und stellte ihr Fragen. Behutsam.
Vorsichtig. Aber Marie sagte nichts.
Der Mann meinte, seine Schwester sei hysterisch, sei das
immer gewesen und die Frau solle diesen Zirkus nicht ernst nehmen.
Die Schwägerin reiste wieder ab, zurück nach England, wo
sie lebte. Aber bevor sie fuhr, nahm sie die Frau zur Seite, sagte: Lass sie
nicht mehr hin! Versprich es mir, lass sie nicht mehr hin!
Die Frau versprach es, ließ das Kind nicht mehr hin, aber
es war zu spät. Nichts wurde wie vorher.
Den Großvater zeigten sie nicht an. Der Mann meinte, sie
wollten nichts zu tun haben mit der Polizei, es sei schließlich sein Vater,
außerdem ein alter Mann, der mit einem Fuß im Grabe stehe, und wer weiß, was
seine Schwester sich da alles zusammenreime, und jetzt könne man sowieso nichts
mehr ändern. Kurze Zeit später verstarb der Großvater tatsächlich, und sie waren
froh, nichts in die Wege geleitet zu haben.
Als Marie dreizehn war, sah die Frau zum ersten Mal die
Schnitte.
Immer war Marie mit langärmligen Shirts herumgelaufen,
aber an jenem Tag war es so heiß, dass sie die Ärmel hochgeschoben hatte.
Die Frau kam von hinten, Marie hörte sie nicht. Sie
starrte diese zerschnittenen Arme an, hatte so etwas noch nie gesehen, all die
Narben, so viele Narben. Als Marie ihre Mutter im Rücken bemerkte, flippte sie
aus, wurde völlig hysterisch. In der Nacht verschwand sie zum ersten Mal.
Einfach so. Zwei Wochen lang wurde sie nicht gefunden. Irgendwann dachte die
Frau, Marie wäre tot. Sie versuchte, es zu spüren, aber sie spürte nichts. Sie
gab sich die Schuld an ihrem Verschwinden. Dann fanden sie sie und brachten sie
zurück. »Ich weiß nicht mehr«, sagte die Frau, »wo sie gewesen ist.« Sie zupfte
am Tischtuch, ihre Finger waren lang und dünn. »Ich hab's vergessen wollen.«
Sie waren zurückgekehrt in den Garten. Herz hatte aus der
Küche Wasser und Gläser geholt, nun stand er am Zaun und schaute in das Wogen
des gelben Meeres und dachte an seine Kinder, an sein erstes dünnes Madchen und
dass einem das Leben in die Suppe spucken konnte, wann immer es wollte. Was
haben wir richtig gemacht, dachte er, und was falsch, und wird das Richtige
reichen? Die Frauen saßen am Tisch, und die leise Stimme von Maries Mutter lag
wie ein Klagelied über dem enden wollenden Sommertag.
»Alles«, sagte Maries Mutter, »fing von vorne an. Mal war
sie da, mal nicht. Wenn sie da war, ging sie zur Schule, wenn nicht, dann eben
nicht. Wir haben alles versucht, und nichts ist gelungen. Wir sind
verzweifelt.« Die Fürsorge schaltete sich ein, die Schulpsychologie, ein Rad
begann sich zu drehen. Marie durchlief zahlreiche Stationen, lebte in
staatlichen Heimen, privaten Sozialwohneinrichtungen, karitativen
Auffangstationen, immer wieder auf der Straße.
Dann die letzte Station. »Ich weiß nicht«, sagte Maries
Mutter, »was hier anders war. Warum sie blieb. Vielleicht war genug Zeit
vergangen, vielleicht war sie inzwischen alt genug, vielleicht spürte sie hier
eine Richtigkeit.« Tatsache war, sie blieb. Schien etwas für sich gefunden zu
haben, machte Therapien, begann wieder zur Schule zu gehen, konnte mit den
Selbstverletzungen aufhören.
»Hier«, sagte Maries Mutter, »haben wir sie kaum gesehen.
Also bin ich regelmäßig da hingefahren, zu diesem Haus, hab mich versteckt, nur
um einen winzigen Blick auf sie zu erhaschen. Wir haben ein Konto eingerichtet.
Haben Geld überwiesen, das Erbe ihres Großvaters.« Sie lachte bitter. Hin und
wieder rief Marie zu Hause an. »Es geht mir gut, Mama«, sagte sie dann. »Mach
dir keine Sorgen. Es geht mir gut.«
Manchmal, ganz selten, kam sie vorbei. Das letzte Mal im
vorigen Jahr, kurz vor Weihnachten.
Maries
Weitere Kostenlose Bücher