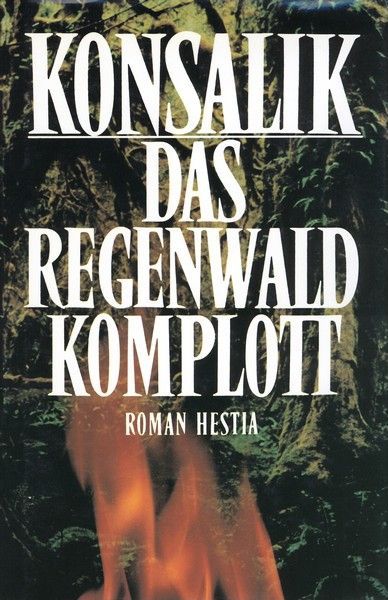![Das Regenwaldkomplott]()
Das Regenwaldkomplott
Militärpolizei, die die Mission besetzen wird. Ihre Briefe an die Bischöfe waren eine Dummheit, Pater Vincence. Aber wir sind bereit, ein Mitglied der Mission auf Santo Antônio zu belassen. Das haben wir dem Bischof von Boa Vista zugesichert. Auch der Gouverneur und Coronel Bilac sind einverstanden. Die Wahl, wer bleibt, liegt bei Ihnen. Wir sind zu dieser Konzession bereit wegen der in Ihrem Gebiet verbreiteten Malaria.«
»Wie großzügig von Ihnen«, antwortete Vincence bitter.
Bejas Reaktion war kalt: »Die Flugzeuge landen morgen im Laufe des Vormittags.«
Es knackte, das Gespräch war beendet.
Pater Vincence ging hinüber zum Hospital und fand sie alle versammelt: Luise, die Schwestern Lucia und Margarida und Luigi.
»Ich habe eben wieder mit Senhor Beja gesprochen«, sagte Vincence und blickte jeden an. »Einer von euch darf auf der Mission, hier im Hospital, bleiben. Wegen der Malaria und anderen Krankheiten.«
»Ich bleibe«, antwortete Luise sofort. »Ich bleibe hier bei Tom.«
»Du hast keine medizinischen Kenntnisse, Luise.«
»Aber ich!« rief Luigi und sprang auf.
»Ich bin seit fünfzehn Jahren Krankenschwester«, sagte Lucia.
»Wir haben fünf Verletzte hier.« Schwester Margarida trat einen Schritt vor. »Was die Zukunft bringt, weiß keiner von uns. Ich bin OP-Schwester, ich allein von euch allen kann sie, so gut es geht, behandeln. Wenn jemand hier im Hospital bleibt, bin ich es.«
Pater Vincence blickte wieder jeden an, dann nickte er. »Schwester Margarida hat die besten Argumente. Sie wird auf Santo Antônio bleiben.«
»Und ich auch!« rief Luise erregt. »Ich lasse Tom nicht allein. Wo er ist, da bin ich auch. Niemand kann mich von seinem Grab wegbringen.«
»Du wirst sehen, was sie können, Luise. Militärpolizei wird die Mission besetzen. Ihr kennt diese Truppe nicht, aber ich. Sie fragt nicht, sie handelt. Sie werden dich, Luise, wenn du dich wehrst, einfach ins Flugzeug werfen wie ein Paket. Laß es nicht darauf ankommen.« Er sah wieder zu Margarida hinüber. »Hast du keine Angst?« fragte er.
»Ich trage ein Ordensgewand. Das greifen sie nicht an.«
Völlig entnervt waren Geraldo Ribateio und seine Polizisten. Coronel Bilac hatte ihm als ersten telefonisch mitgeteilt, daß die FUNAI als zuständige Behörde die Mission schließen müsse. Neue Befehle seien abzuwarten. Ribateio bekam bei diesem Gespräch rote Augen und atmete so schwer, als trage er eine Zentnerlast.
»Senhor Coronel«, fragte er und bemühte sich, eine halbwegs ruhige Stimme zu haben, »bleibt unsere Polizeistation bestehen?«
»Das weiß ich noch nicht, Tenente. Das wird von höherer Stelle aus entschieden. Es ist geplant, die Mission mit Militärpolizei und Elitetruppen zu besetzen, eine Art Basis für kommende Aktionen. Ob Sie dann noch in Santo Antônio gebraucht werden, wird sich herausstellen.«
Auf der Polizeistation der Mission herrschte eine gedrückte Stimmung. Auch wenn es immer wieder mit den Patres zu Reibereien gekommen war, zu Meinungsverschiedenheiten vor allem über das Indianerproblem – für Ribateio war Santo Antônio so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Er konnte sich gar nicht mehr vorstellen, woanders als hier zu leben, und wenn er und Pater Ernesto auch immer im Streit lagen, für ihn war Ernesto eine Art Vaterersatz. Wenn Ernesto ihn mit den wildesten Worten beschimpfte, die durchaus nicht immer der Würde eines geweihten Priesters entsprachen, war er oft bereit, zu sagen: »Ja, Patre«, und er meinte damit den Vater und nicht den Geistlichen.
Nicht anders erging es den Sergentos Moaco, Perinha und den anderen Polizisten. Die Aussicht, daß man sie nach Surucucu oder gar Boa Vista versetzte, ließ in ihnen eine Art Schwermut aufkommen, der sie nur mit Alkohol entrinnen konnten. So waren sie nach dem Telefonat mit Bilac zwei Tage lang dienstunfähig, weil sie ohne Ausnahme betrunken waren.
Nach Bejas Ankündigung sollte am 24. August 1987 die Mission von der Regierung übernommen werden.
»Jetzt ist es Zeit, daß ihr wegkommt«, mahnte Vincence am 22. August Ernesto, Minho und Sofia. »Ein Vorsprung von zwei Tagen ist nicht viel. Sie werden Hubschrauber einsetzen, vergeßt das nicht. Sie werden euch suchen, vor allem dein Vater, Sofia. Macht euch auf den Weg.«
Am Nachmittag dieses Tages war das große Aluminiumboot beladen mit allem, was sie für die nächste Zeit brauchten. Kisten mit Medikamenten, Verbandszeug, Spritzen, medizinische Instrumente, ein Mikroskop,
Weitere Kostenlose Bücher