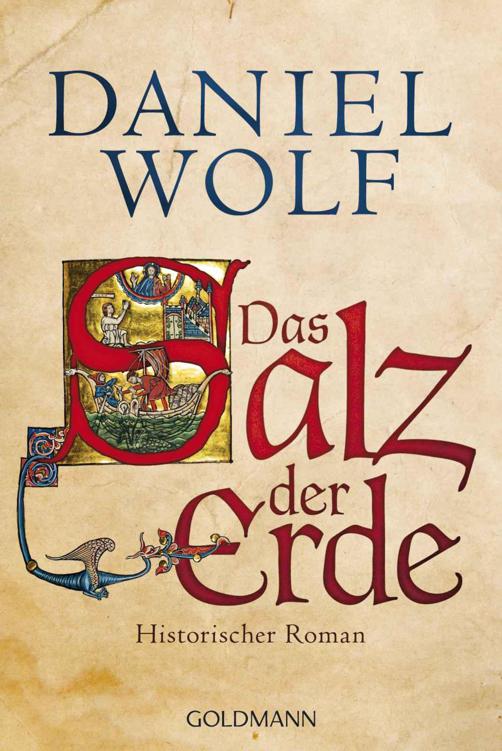![Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)]()
Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)
dahintersteckte, weiß Gott allein.«
Michel beließ es bei einem Nicken. »Die Brücke war eine enorme Erleichterung für den Salzhandel. Die Gilde bittet Euch daher um die Erlaubnis, sie wiederaufbauen zu dürfen.«
»Varennes braucht keine eigene Brücke. Nutzt die Brücke der Familie de Guillory.«
»Dort müssen wir auf jede Warenladung Zölle zahlen.«
»Das ist mir durchaus bekannt, Herr de Fleury. Aber fünf von hundert Teilen sind wahrlich nicht zu viel. Zumal ich Euch bereits bei den Steuern und Marktzöllen entgegengekommen bin.«
Michel hatte mit solch einer Entscheidung gerechnet. Dass es Simon ehedem nicht gelungen war, sich die Saline anzueignen, ärgerte ihn bis zum heutigen Tag, und er wollte dem Herzogtum – beziehungsweise dem Vasallen, der dereinst de Guillorys Lehen bekommen würde – wenigstens einen kleinen Teil der Einkünfte aus dem Salzhandel sichern. »Können wir etwas tun, um Euch umzustimmen?«
»Nein.« Simon winkte einen Pagen heran, der ihm aufhalf. »War das alles? Ich bin müde und möchte mich zurückziehen.«
Seit Tagen beschäftigte Michel ein waghalsiger, geradezu tollkühner Gedanke. Er gab sich einen Ruck und fragte: »Wie viel würdet Ihr für ganz Varennes verlangen?«
Simon blickte ihn mit trüben Augen an. »Wovon redet Ihr, Mann?«
»Angenommen, die Bürgerschaft würde die Stadt mitsamt den Ländereien und allen Rechten und städtischen Einrichtungen kaufen wollen – was wäre Euer Preis?«
»Ist das der Wunsch der Bürgerschaft?«
»Wir sehnen uns schon lange danach, unsere eigenen Herren zu sein.«
Simon stand neben dem Tisch, gestützt auf seinen Pagen, und dachte lange nach. »Ihr wisst, was ich damals Erzbischof Johann für Varennes gezahlt habe.«
»Achttausend Pfund Silber.«
»Könnte die Bürgerschaft diese Summe aufbringen?«
»Wahrscheinlich nicht – die letzten Jahre waren hart. Aber die Hälfte wäre zu schaffen.«
»Viertausend Pfund sind zu wenig für eine Stadt dieser Größe. Aber da meine Familie Euch viel verdankt, mache ich Euch ein Angebot: sechstausend, und ich entlasse Varennes in die Selbstverwaltung.«
»Habt Dank, Euer Gnaden.« Michel verneigte sich tief, während Simon gebeugt aus der Kammer schlurfte.
»Sechstausend?«, rief Duval. »Diese Summe bringen wir in hundert Jahren nicht zusammen. Selbst wenn alle Schwurbrüder ihr letztes Hemd geben, schaffen wir vielleicht ein Fünftel. Höchstens.«
»Wenn ich Herrn de Fleury richtig verstanden habe«, sagte Archambaud Leblanc, der mit Jean Caboche und den anderen Führern der Bruderschaften inmitten der Schwurbrüder in der Gildehalle saß, »sollen die Kaufleute das Geld nicht allein aufbringen. Die ganze Stadt soll sich beteiligen.«
Michel nickte. »Die Gilde, die Bruderschaften, die Arbeiter und Tagelöhner, sogar die Ministerialen – alle.«
»In Form einer Steuer?«, fragte Eustache Deforest.
»Wir dürfen keine Steuern erheben. Aber wir können Spenden sammeln. Jeder gibt, so viel er kann.«
»Warum sollten sich die einfachen Leute auf so etwas einlassen?«, warf Isoré Le Roux ein. »Sie haben ohnehin kaum genug zum Leben.«
»Das liegt doch auf der Hand«, antwortete Michel. »Sie haben am meisten unter de Guillory und zuvor unter Bischof Ulman gelitten. Wenn wir uns selbst verwalteten, wären sie nicht mehr der Willkür der Kirche und des Adels ausgeliefert. Ich bin sicher, dass sie bereit wären, dafür ein paar Silberstücke zu geben. Ist es nicht so?«, wandte er sich an die Führer der Bruderschaften.
»Unsere Leute haben es satt«, stimmte Jean Caboche ihm zu. »Sie wollen endlich mitreden bei Steuern, Marktzöllen und allem anderen.«
Leblanc und die anderen Führer nickten.
»Trotzdem«, sagte Le Roux. »Sechstausend Pfund sind unvorstellbar viel Geld. Ich frage mich, ob das wirklich nötig ist. Gerade sieht es doch ganz gut für uns aus.«
»Ja, aber wie lange bleibt das so?«, erwiderte René Albert. »Was ist, wenn der Herzog seine Meinung ändert und uns nächstes Jahr einen neuen Stadtherrn hinsetzt, womöglich einen Kerl wie de Guillory? Oder wenn er stirbt und sein Bruder alle Vereinbarungen widerruft?«
»Oder wenn es zum Machtkampf zwischen Ferry und seinem Sohn kommt und beide versuchen, uns für ihre Zwecke einzuspannen?«, ergänzte Deforest. »Ihr habt den Herzog gesehen – er hat höchstens noch ein paar Monate. Wer weiß, was nach seinem Tod geschieht.«
»Genauso ist es«, sagte Michel. »Herzog Simon gewährt uns die
Weitere Kostenlose Bücher