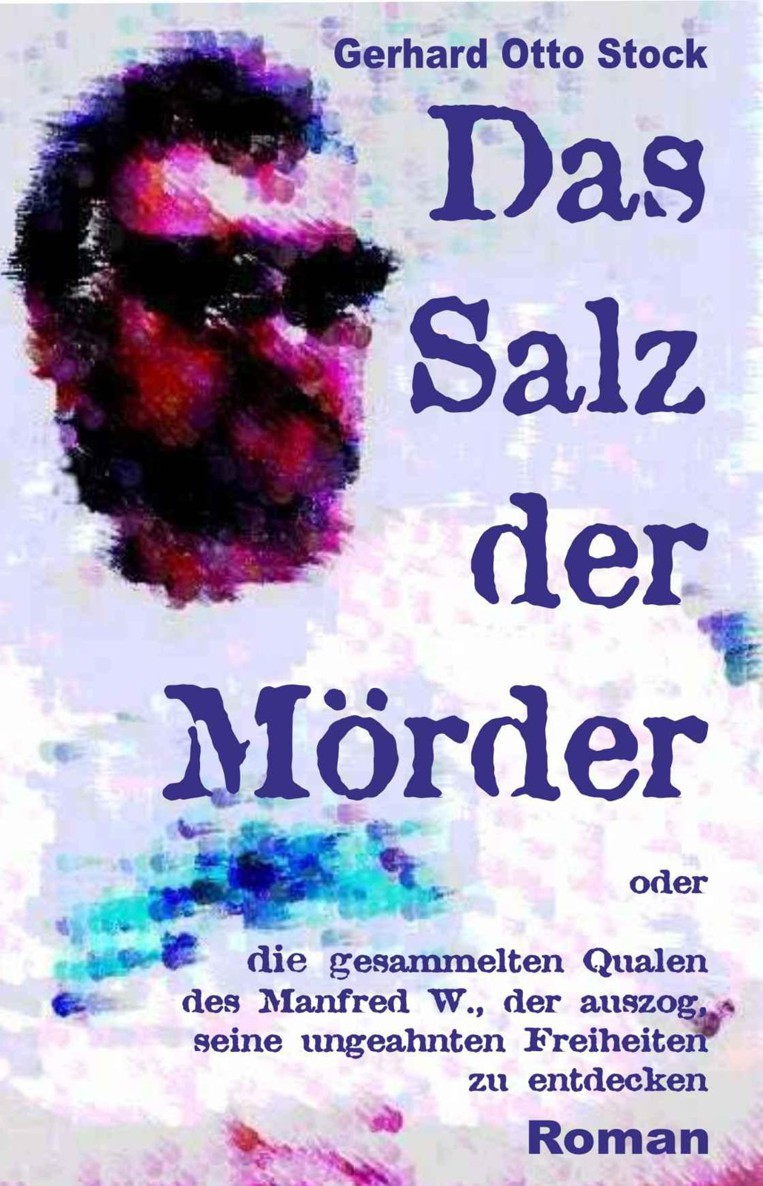![Das Salz der Mörder]()
Das Salz der Mörder
P rolog
Sehr
geehrte Frau Schwarzkopf,
gewiss
werden Sie sich noch an mich erinnern. Mein Name war Manfred Wegner, jetzt Ted
Berliner. Wir begegneten uns vor einiger Zeit auf einer Geschäftsreise in
Brasilia. Nach unserem Gespräch im „Hotel Planalto Bittar“ zeigten Sie großes
Interesse meine Biographie zu publizieren. Fernerhin wollten Sie mich mit einem
renommierten Autor bekanntmachen, der meine Erlebnisse professionell zu Papier
bringen kann.
Leider
habe ich bis heute nichts mehr von Ihnen gehört, gnädige Frau. Inzwischen waren
verschiedene Zeitungen und Magazine bereit meine Lebensgeschichte exklusiv zu
vermarkten, was ich selbstverständlich ablehnte. Daher kam mir die
abenteuerliche Idee, mich selbst an den Schreibtisch zu setzen, mit dem Ziel,
mir all das von der Seele zu schreiben, was mich seit Jahren in, zu teilweise,
schwere Depressionen stürzte. Ich versuchte mich noch einmal mit den
verworrenen Geschehnissen auseinanderzusetzen, die mein bisheriges Leben so
gravierend beeinflussten. Dummerweise sah ich ein unüberwindbares Hindernis, welches
mich lange davon abhielt zur Feder zu greifen. Es war nicht die Zeit, denn Zeit
existiert für mich nicht. Es waren auch nicht die Ruhe und Ausgeglichenheit,
die man zum Schreiben benötigt. Nein. Es war die Angst vor dem Schreiben
selbst: bin ich eigentlich der deutschen Sprache, der Grammatik und
Orthographie noch kundig und mächtig, den heimtückischen Gesetzen der
Interpunktion, und werde ich mich einigermaßen verständlich ausdrücken können?
Das waren die widrigen Faktoren, die ich bezwingen musste, die mich
einschüchterten und entmutigten. Doch es kam der Moment, an dem ich die Kraft
aufbrachte, diese Bedenken zu bezwingen.
Ich
ahnte nicht, wie mir die tägliche Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit
helfen würde von meinen krankhaften Gedanken befreit zu werden. Pro Tag tippte
ich eine, an guten Tagen sogar zwei DIN A4 Seiten mit Buchstaben voll. Als
Berater und Lektor fungierte allabendlich stets meine Frau Veronika, die sich
allem Anschein nach mehr über meine Schreibkünste wunderte als ich selbst.
Durch
das Schreiben habe ich auch wieder die Autorität der Zeit von neuem entdeckt.
Dadurch wurde mir ebenso bewusst, dass ich mittlerweile sieben Jahre älter als
mein Vater bin. Das ist ein merkwürdiges Gefühl – glauben Sie mir -, weil mein
einstiger kindlicher Respekt vor ihm mit den Jahren nicht etwa proportional zum
Alter verblasste, sondern im Gegenteil, er hat sich noch vertieft in mir.
Meiner Mutter und meiner Großmutter gedenke ich fast täglich. Denn sie waren
es, die mich von Kindheit an prägten. Ich sehe immer diesen verschneiten
winterlichen Dorffriedhof vor mir, von dem ich Ihnen erzählte.
Nun
allerdings, nach Fertigstellung meiner qualvoll durchlittenen und geschilderten
Lebenserinnerungen, bin ich etwas unschlüssig, schwankend. Sollte ich Ihnen,
werte Frau Schwarzkopf, meine Aufzeichnungen zur Veröffentlichung in Ihrem
Verlag anbieten oder nicht? Einerseits habe ich es finanziell nicht nötig, wie
Sie wissen werden, andererseits brauche ich die Öffentlichkeit, um ihr endlich
verständlich zu machen, was mich dazu trieb, eben so zu handeln und nicht
anders. Dann wiederum frage ich mich, wieso ich jetzt auf dieses Publikum
angewiesen bin? Suche ich nach Rechtfertigung, suche ich nach Anerkennung oder
gar Vergebung? Will ich mich von einer Gesellschaft freikaufen, die es gar
nicht wert ist, dass man sich mit ihr befasst? Oder will ich möglicherweise in
Frieden mit mir selbst sein? Ich bin gesinnungslos genug, um tatsächlich zu
glauben, dass man nicht alles im Leben kaufen kann, obwohl die Mittel dazu
vorhanden wären - wenn Sie verstehen, was ich meine. Ein Verbrechen ist kein
Verbrechen, wenn keine Moral existiert. Und was Moral bedeutet, wird man erst
begreifen, wenn man gesehen hat, dass selbst ein Bettler nicht von jedem eine
milde Gabe annimmt.
Ich
schätze Sie sehr, gnädige Frau, und ein anregendes Gespräch mit Ihnen, würde
meiner Frau und mir vielleicht helfen über grundlegende Fragen abschließende
Meinungen zu formulieren.
Als
ich auszog meine Freiheiten zu entdecken, hätte ich wissen müssen, wie es ist,
nicht stark genug zu sein und dass der Übergang von einer geschlossenen
Gesellschaft in eine offene so manchem das Genick brechen würde. Warum wusste
ich das nicht? Weshalb kannte ich das kleine Einmaleins der Ellenbogen nicht?
Versagte ich deswegen so kläglich in der so genannten
Weitere Kostenlose Bücher