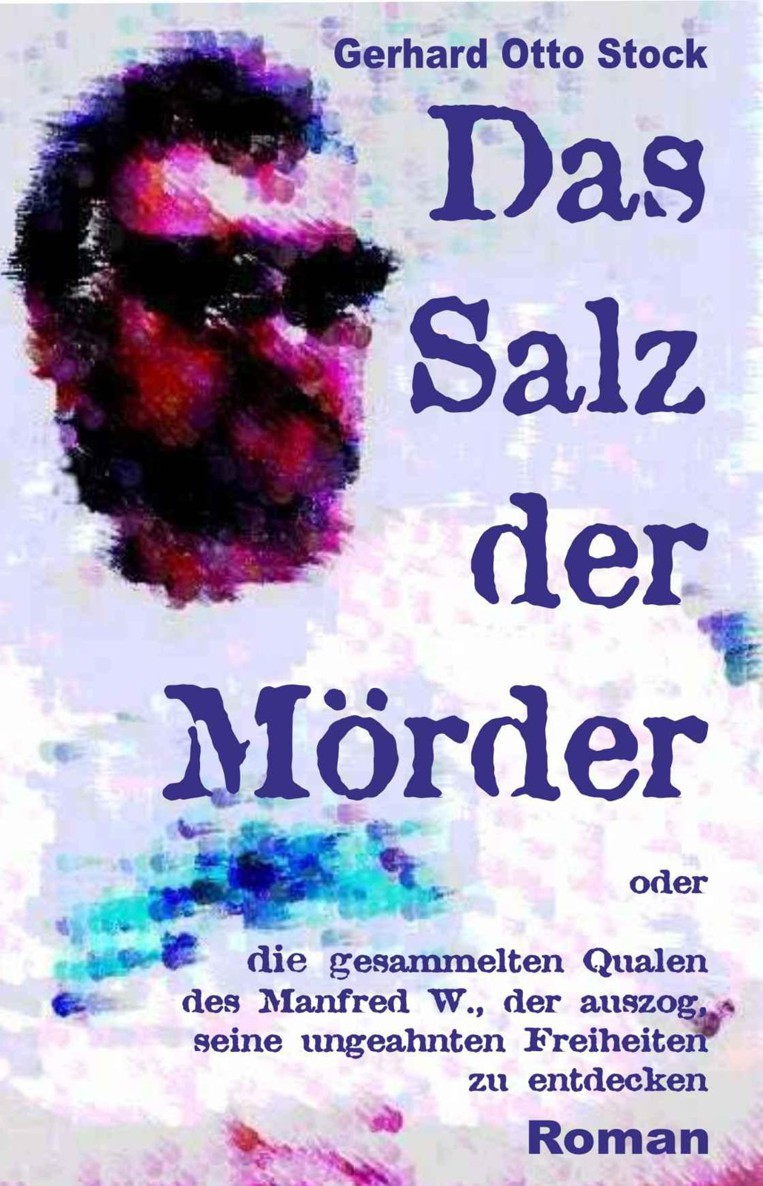![Das Salz der Mörder]()
Das Salz der Mörder
die ihm zu schaffen machen. Was sollte es sonst sein? Ich
kenne ja die absonderlichen Methoden, die die Einheimischen mit ihren
ausländischen Teilhabern vollziehen, um sie in den Ruin zu treiben und sich
selbst dabei bereichern.
Bevor
ich die Haustür öffne, betrachte ich mich noch einmal im Korridorspiegel, und
ich gefalle mir gut: mein gelber Strohhut sitzt etwas schräg, das
Spazierstöckchen in der rechten und die qualmende Tabakspfeife in der linken
Hand – so stellt man sich einen rüstigen Rentner vor. Papandreou bürstet
schweigend mein Sakko ab und sieht mich durch den Spiegel kopfschüttelnd an.
Mit einer versteinerten Miene vergebe ich ihm seinen unangemessen
Gefühlsausbruch.
Beim
Gehen werde ich ein Bein leicht nachziehen, das wirkt dann gewiss noch
harmloser, sage ich zu mir und trete auf den Bürgersteig. Gelangweilt
schlendere ich auf die Zivilisten zu, dabei ziehe ich ab und zu an meiner
Pfeife und stoße mit meinem Stöckchen hörbar auf die Gehwegplatten. Die Herren
diskutieren, nur die Dame steht etwas abseits. Mittlerweile scheinen sie mich
bemerkt zu haben. Immerhin liegen noch mindestens zweihundert Meter Distanz
zwischen mir und ihnen, doch unverdrossen spiele ich die Rolle des zufälligen
Spaziergängers weiter. Langsam komme ich näher. Schon von weitem hänge ich den
Spazierstock über meinen linken Arm, ziehe freundlich den Strohhut und begrüße
die unbekannten Herren: „Kann ich Ihnen helfen? Ich kenne den Besitzer des
Anwesens.“ Der korpulente Mann in der prächtig ausstaffierten Polizeiuniform
wirft einen kurzen Blick auf einen der umstehenden Herren. Jener nickt,
wahrscheinlich ein Zeichen des Einverständnisses. Der dicke Polizist wälzt sich
mir breitbeinig entgegen. Ich halte immer noch meinen Strohhund in der Hand und
das Stöckchen über den Arm, und ich grüße nochmals. Ohne eine Erwiderung, fragt
er: „Sie sagten, Sie kennen den Besitzer?“
„Ja,
natürlich, Ted Berliner ist mein Nachbar“, antworte ich, nun etwas weniger
freundlich und deute mit dem Krückstock ruckweise auf meine Villa. Die
verdammte Tabakspfeife brennt mir zwischen den Fingern, denke ich dabei. „Ist
denn irgendetwas nicht in Ordnung?“ frage ich zögernd. Mit einem Mal entsteht
hinter mir Unruhe. Der Fahrer des LKWs öffnet die Plane seines Fahrzeuges. Ich
sehe erschreckt, wie zirka dreißig Polizisten von der Ladefläche springen. Alle
sind sie mit kleinen Schnellfeuergewehren ausgerüstet. Sie formieren sich zu
einem Zug.
„Die
Zivilisten, die sich hinter mir so angeregt unterhalten, wie Sie gewiss
bemerken, sind von weither angereist, um gern mit Herrn und Frau Berliner zu
sprechen. Und wenn Sie als Nachbar veranlassen könnten das Tor zu öffnen, wären
Ihnen die hier anwesenden Herrschaften sicher sehr dankbar“, entgegnet der
Polizeioffizier gekünstelter Freundlichkeit. Er sprach diesen unausstehlichen
Akzent aus dem Norden des Landes. Daraufhin erwiderte ich im feinsten
Portugiesisch: „Soviel ich weiß, ist die Familie Berliner deutscher Abstammung.
Worum geht es denn? Haben sie vielleicht etwas geerbt?“ Meine Frage scheint
meinem Gegenüber nicht besonders zu gefallen, denn mit einem überaus entrüsteten
Blick sieht er zu seinem Polizeikommando. Mit ausgestrecktem Arm deutet er auf
sie, und zu mir gewandt, fragt er etwas gereizt: „Sind Sie nun im Stande das
Tor öffnen zu lassen oder sollen es meine Leute tun?“ Der Mann wurde immer
erregter. Während dieses unerfreulichen Gespräches, sehen die Herren und die
einzelne Dame unablässig zu uns herüber. Durch dieses Aufgebot bewaffneter
Potenz, werde ich etwas unsicher – das muss ich zugeben. Ich verliere fast
meine Beherrschung. Ich fühle die Blicke dieser dreißig oder vierzig Männer auf
mich gerichtet. Ob bewaffnet oder unbewaffnet, jeder Einzelne von ihnen
erwartet irgendeine Reaktion von mir. Wie versteinert halte ich Tabakspfeife,
Spazierstock und Strohhut an mich gepresst, ohne den glühenden Pfeifenkopf zu
spüren, der sich zum reinsten Lötkolben verwandelt hat. Meine Augen kreisen von
einem zum anderen. Von hinten strömt der Geruch von frisch geölten Waffen und
eingewichsten Stiefeln auf mich ein.
Die
Dame, die die ganze Zeit abseits steht und sich scheinbar nicht an dieser
ganzen Operation beteiligt fühlt, dreht sich plötzlich zu mir um, dabei schwebt
mir ein süßlicher Lavendelduft in meine überraschte Nase. Verächtlich spricht
sie mich an: „Spielen Sie doch hier nicht den vertrottelten
Weitere Kostenlose Bücher