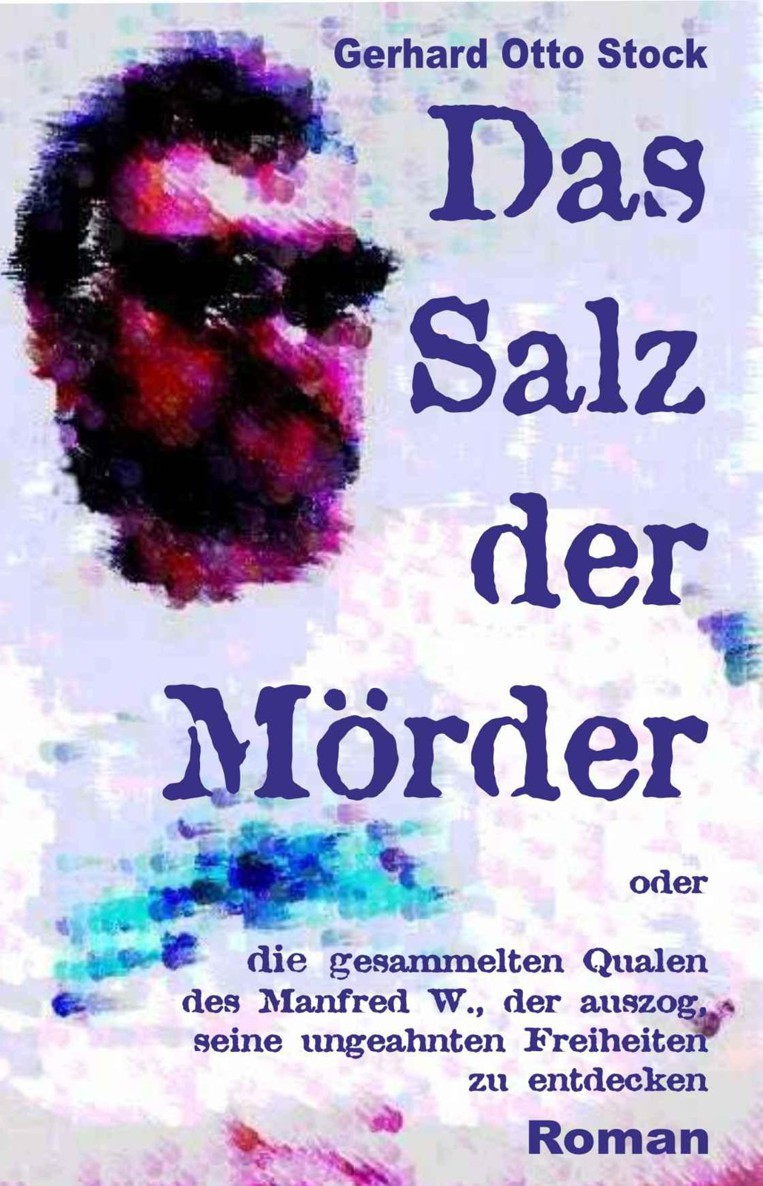![Das Salz der Mörder]()
Das Salz der Mörder
auf. Ich kannte ihn ja schon vom
letzten Mal, als er hier war. Er sprach am lautesten, denn er hatte eine neue
Eroberung mitgebracht. Seit einem halben Jahr reiste er unverdrossen mit seiner
Peggy durch die ganze Welt. In Singapur schließlich trennten sich ihre Wege.
Auf einer Handelsmesse des malaiischen Wirtschaftsministeriums lernte David
Li-tai kennen, eine attraktive Chinesin Anfang dreißig, die in Kuala Lumpur
lebt und eine äußerst erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein scheint. Peggy
entdeckte verärgert, dass auch sie der Eifersucht fähig war und flog mit
der nächsten Maschine und erhobenen Hauptes zurück nach London. Alle
Beteuerungen Davids, dass es sich bei Li-tai um ein leidiges Missverständnis
handelt, schüttelte Peggy mit ihrem unübersehbaren knallroten Haar hysterisch
beiseite, während sie beim Einsteigen in die Boing der Stewardess lässig das
Bordticket überreichte. Nun saß mir die liebliche Li-tai gegenüber. Mit ihren
braunen Mandelaugen verfolgte sie scheu alle Aktivitäten Davids. Mir schenkte
sie hin und wieder ein schüchternes asiatisches Lächeln.
Auch
Daniel verhielt sich sehr ungezwungen, drängte jedem ein Glas Ananasbowle auf
und berichtete stolz, dass er Ende Juni vorzeitig seinen Doktor in Physik
machen würde. Das Einstellungsformular von der NASA hatte er schon in der
Tasche. Mein Gott, dieser Junge ist wirklich ein Teufelskerl, dachte ich: vom
Kochen über Anthropologie zur Physik bis hin zur Raumfahrt.
Teds
Schwiegereltern unterhielten sich angeregt mit Gaby, die den kleinen Steven auf
ihrem Schoss hielt. Vera, Maria und José kümmerten sich um die Speisen und
Getränke. Kalle diskutierte mit Ted über die letzten Entwicklungen ihrer Foundation.
Ich erörterte mit Marianne, die Unterschiede zwischen einem
Transportunternehmen und einer Reederei.
Punkt
drei Uhr morgens flüsterte mir Ted ins Ohr, dass der Inhalt meiner Kiste
Rotwein aufgebraucht sei, was mich nicht im geringsten verwunderte, denn ich
meinte zu ihm: „Deine Leute trinken das gute Zeug genau wie ich: wie Wasser.
Wenn du willst, kannst du jetzt nach meinem Hausarzt rufen lassen.“
„Nicos,
seit gestern Morgen mag ich deine makaberen Witze nicht mehr. Du solltest ein
bisschen mehr auf dich acht geben, hörst du? Ich möchte nicht nach meiner
Rückkehr von unserem Hochzeitsausflug dein Grab schaufeln müssen.“
„Früher
oder später wird sich das wohl kaum vermeiden lassen. So, mein Junge, ich
glaube, ich sollte mich langsam auf den Heimweg machen. Mir schwindelt ein
wenig. Nun schau mich nicht so an – ja, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen
betrunken. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Sei vorsichtig, und bring dich und
deine Gäste gesund nach Hause zurück. Also, dann ‚Ahoi’. Ich werde euch noch
eine Kiste Roten bringen lassen. Ihr hört ja doch noch nicht auf.“
Es
ist Dienstagmorgen, der 6. Mai, fast zwei Stunden nach Mitternacht, und ich
sitze hier, und ich schreibe alles nieder, was bisher geschehen war, und weiß
nicht, wie lange ich für meine Aufzeichnungen benötigen werde.
Seit
der nächtlichen Empfangsfeier in Teds Haus war also ein gute Woche vergangen.
Um
Sie, verehrte Leser, nicht zu verunsichern, muss ich zunächst erwähnen, dass
ich das Manuskript des vorliegenden Buches „Das Salz der Mörder“ von Herrn Ted
Berliner oder von Herrn Manfred Wegner – wie immer Sie wollen – erst drei Jahre
nach dessen Fertigstellung unter sehr widrigen Umständen in die Hände bekam.
Ich meine, ich bekam es gestern Morgen in die Hände. Wie das allerdings vor sich
ging, möchte ich nachfolgend mit meinen eigenen, einfachen Worten darlegen.
Von
der ersten bis zur letzten Seite habe ich seinen Räuberroman gelesen – ja,
regelrecht verschlungen habe ich ihn. Gerade schlug ich den dicken Hefter zu.
Ich ziehe die Möglichkeit in Erwägung, ihn später zu publizieren, denn was er
so daher schreibt, scheint mir äußerst bemerkenswert – insbesondere die
deutschsprachige Leserschaft wird ein erhebliches Interesse an seinen
Darlegungen haben, vermute ich.
Natürlich
war ich nach der Lektüre der vorangegangenen Aufzeichnungen von meinem
jugendlichen Freund und seiner Familie zutiefst enttäuscht. Wie war es nur
möglich, dass sie mich all die Jahre belogen, mich nicht ins Vertrauen gezogen
haben? Ich behandelte sie doch wie meine eigenen Kinder. Was wäre aber
geschehen, sage ich schließlich, wenn sie mir von Anfang an die reine Wahrheit
erzählt hätten? Ich möchte mich hier nicht zu
Weitere Kostenlose Bücher