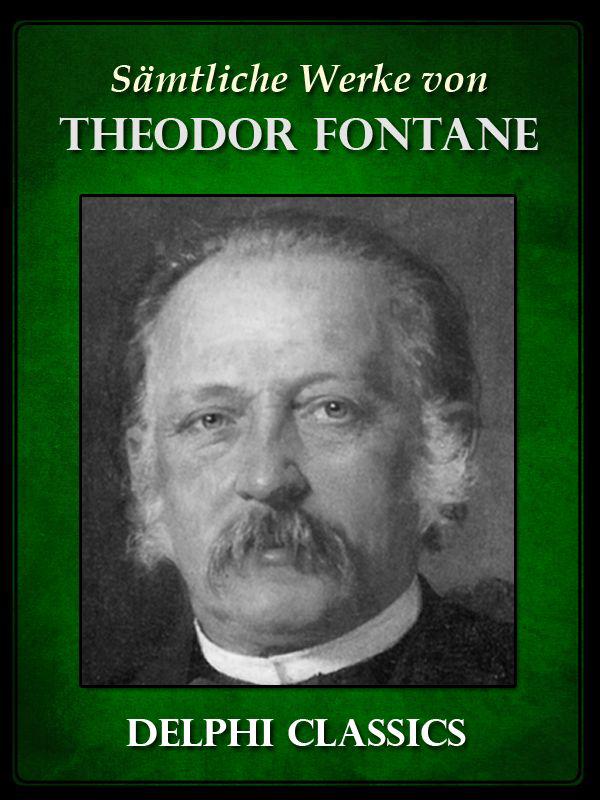![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
erschien ihm altmodisch und vernachlässigt, weshalb er ihre Führung selber übernahm. »Ich habe Schreyer«, so schrieb er an Alexandrine D., »aus der Pacht entlassen und ihm 9400 Taler für Superinventarium und Vorräte gezahlt. Er konnte keinen besseren Zeitpunkt finden, weil alles jetzt in doppeltem Werte steht.«
Aber dies Entlassen des Pächters aus der Pacht war nur eins. Auch in seiner eignen unmittelbaren Umgebung gefiel ihm nicht alles, und er zeigte sich gewillt, auch hier eine Reform eintreten zu lassen.
Als erstes Opfer fiel »die Hohendorff«, ein adliges Fräulein, das schon zu Lebzeiten der Frau von Hertefeld dem Hause zugehört und sich namentlich unmittelbar nach dem Tode derselben unentbehrlich zu machen gesucht hatte. Nicht ohne zeitweiligen Erfolg. Aus ihrem weitern Leben aber erlaubt sich der Schluß, daß sie dabei von ziemlich selbstsüchtigen Motiven geleitet wurde. Der alte Freiherr durchschaute dies und schüttete darüber sein Herz aus. »Ich fühle mich der Hohendorff, wegen ihrer früheren Dienste, wirklich verpflichtet, es bleibt aber dabei, daß es schwer mit ihr zu leben ist. Immer ist sie krank, will es aber nicht wahrhaben und gefällt sich in diesem Heldensinn.« Und an andrer Stelle: »Ich mag nicht geradezu behaupten, daß es ihr an gutem Herzen fehlt, auch weiß sie sich in Gesellschaft gut genug zu benehmen. Aber an allem andren gebricht es ihr, und Einsicht, richtige Menschenbeurteilung und Unterscheidungskraft wird sie nie bekommen.« In der Tat, ihr nervös aufgeregtes, altjüngferlich verschrobenes Wesen, in das sich vielleicht auch stille Hoffnungen mischten (wenn diese nicht die Wurzel alles Übels waren), machte schließlich ein längeres Zusammenleben mit ihr unmöglich, und sie wurde zu benachbarten Predigersleuten in Pension getan, aus welcher Abgeschiedenheit sie zehn Jahre später noch einmal erscheint, inzwischen in völlig »hysterisch-pietistische Verrücktheit« verfallen.
Es blieb aber nicht bloß bei der Hohendorff, und im Spätsommer 1803 war überhaupt ein aus neuen Elementen bestehender Kreis geschaffen, der nun durch viele Jahre hin ausdauerte.
Genauer angesehen, war dieser Kreis ein doppelter, und zwar ein äußerer und ein innerer. Der äußere bestand aus dem Wirtschaftspersonale, dessen in den Briefen immer nur kurz und wie gelegentlich Erwähnung geschieht, während die Gestalten des inneren Zirkels auf jeder Blattseite wiederkehren und zuletzt in aller Leibhaftigkeit vor uns stehen. Es waren dies: Demoiselle Neumann, der alte Tackmann, der junge Reichmann und Herr Hauslehrer Greif. Alte vier erfreuten sich der Auszeichnung, nicht bloß Haus-, sondern auch Tischgenossen zu sein. Ebenso gestaltete sich ihr Einvernehmen untereinander aufs beste.
Demoiselle Neumann , die jetzt das Haus regierte, war alles, nur keine Dame, wodurch sie gerade des Vorzuges genoß, nach dem sich der alte Freiherr durch Jahre hin am meisten gesehnt hatte. »Ich habe jetzt eine Demoiselle Neumann engagiert«, so schreibt er an Alexandrine D., »keine elegante Gouvernante, denn sie weiß nichts von Französisch, aber aus einem guten Bürgerhause, sorglich, umsichtig, fleißig.« Und bald darauf: »An die Spitze der Ökonomie hab ich jetzt die Neumann gestellt, die das alles versteht, weil sie vor Jahren schon auf dem Amte Blankenfelde die Wirtschaft gelernt hat und mit anzugreifen weiß. Und auch wirklich mit angreift. Da müssen denn die Mägde folgen. Sitzet aber die Haushälterin auf dem Lehnstuhl, so setzen sich die Mägde auf den Strohsack.« Alles, was von Vertrauen aus diesen Zeilen spricht, bestätigte sich, und die Neumann, »treu wie Gold« und von selbstsuchtsloser Ergebenheit, wurd in allen Sachen des Hauses und der Familie Beistand und Beraterin. In Ehren dienend, beglückte sie das Haus, dem sie diente, wobei sich’s freilich auch wieder zeigte, daß ein solches freies und selbstsuchtsloses »Für-andere-da-Sein« im Laufe der Jahre zur Herrschaft über diese anderen führt. Alles hatte Respekt vor ihr. Einmal warf eine der jungen Damen ein Stückchen Band aus dem Fenster, und die Neumann, als sie’s aufgesucht, bracht es mit der Reprimande zurück: »So was wirft man nicht auf die Straße.«
Ihr an Ansehen zunächst stand der alte Tackmann , von Profession ein Zuckerbäcker, der in seiner Jugend weite Reisen in überseeische Länder gemacht hatte. Namentlich war er das Entzücken des nun zehnjährigen Karl von Hertefeld und hatte dabei das Vorrecht,
Weitere Kostenlose Bücher