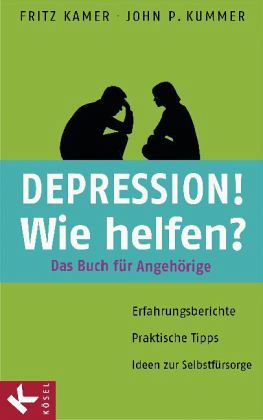![Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige]()
Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige
Gegen einen neuerlichen Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt wehrte ich mich, und so fand meine Frau eine »normale« Klinik, die mich für die Zeit der Infusionen beherbergen würde. Der Aufenthalt dauerte etwa vier Wochen.
Inmitten von herz- und kreislaufgeschädigten Patienten fühlte ich mich einsam, stigmatisiert, »anders«. Ich konnte kaum Kontakt mit meiner Umgebung herstellen. Eine mir wohlgesinnte Ärztin verhalf mir zu einem einigermaßen angenehmen Aufenthalt in der wunderschön an einem Seeufer gelegenen Klinik.
Als ich wieder nach Hause kam, war man der einhelligen Ansicht, dass es mir etwas besser ginge. Das konnte ich als Minderheit nicht wirkungsvoll in Abrede stellen, aber für mich persönlich ging das depressive Er-Leben weiter, und zwar noch ungefähr zwei Wochen.
Plötzlich, eines Morgens, beim Erwachen, war alles ein bisschen anders. Ich hatte gut geschlafen, und es war Stunden nach meiner gewohnten Aufwachzeit während der Krankheit. Ich erblickte das aus dem schrägen Dachfenster kommende Licht. »Der Himmel ist blau«, sagte ich zu mir ganz zufrieden. »Wer weiß, vielleicht wird dies ein schöner Tag!« Während der Depression war der Himmel oft auch strahlend blau gewesen, aber es hatte bedrohlich auf mich gewirkt, dass ein neuer Tag begann.
Ich stand auf, wackelig zwar, aber mit etwas mehr Spannkraft als sonst. Unten war der Frühstückstisch noch für mich gedeckt, meine Frau war jedoch bereits weg. Vorher war ich kaum je allein, denn ich brauchte ständig menschliche Nähe, obschon mir jedes Gespräch, das unvermeidbar war, sehr schwer fiel. Einfach jemanden, der da wäre, für den Fall … An diesem Tag aber hatte ich plötzlich kein Problem mehr mit dem Alleinsein. Ja, da lag noch ein Zettel mit der beruhigenden Nachricht für alle Fälle, wo meine Frau erreichbar wäre.
Das Leben und vor allem das Erleben veränderten sich fast stündlich und ich entdeckte eine um die andere meiner alten Fähigkeiten wieder. Und die Außenwelt veränderte sich ebenfalls, sie bekam Farbe und wurde freundlich, spannend, ereignisreich, teils altgewohnt und doch auf eine Art brandneu und höchst attraktiv. Ich war wieder da, im Leben!
1 Das »Biopsychosoziale Krankheitsmodell« umfasst drei Faktorengruppen: biologisch: Erbfaktoren, Hormonstörungen (Schilddrüsenüberfunktion); psychologisch: traumatische Erfahrungen: Missbrauch, Gewalt, emotionale Vernachlässigung, Verluste; sozial: Stress, Trennungen, Trauer, Verlust sozialer Kontakte, Mobbing
Die Depression von außen betrachtet – Einige allgemeine Aspekte der Depression
Unwissenheit und Schuldgefühle
Das Phänomen Depression hat für die Gesunden etwas Mystisches an sich: Viele wissen wenig, viele vermuten viel, behaupten zu wissen, fürchten sich aber vor einer näheren Beschäftigung mit der Krankheit. Daran sind nicht zuletzt die Betroffenen selber schuld. Zu oft hüllen sie sich schamhaft in Schweigen – oder sie referieren gebetsmühlenhaft über ihre Befindlichkeit.
Zur Mystik: Es sind eine ganze Reihe von »Erklärungen« zur Depression im Umlauf. Die unheilvollsten haben mit »Schuld« zu tun: Gott schlägt die Schuldigen mit Irresein – also ist eine Depression eine Strafe Gottes!
Wenn schon diese »Erklärung« auf dem Rückzug ist, so wird sie doch von manchem Depressionsbetroffenen selber weiter gepflegt: »Ich bin selber schuld!« Er schämt sich seines Zustandes und will ihn unbedingt verändern. Dass ihm dies meist nicht sofort gelingt, erfüllt ihn mit Selbstvorwürfen.
Andere, grundsätzlich irrationale Schuldgefühle wie »Ich bin schuld am Zerwürfnis meiner Eltern«, ja sogar »am Tod meiner Schwester« führen oft geradewegs in die Depressivität.
Weiter in den Teufelskreis der Minderwertigkeitsgefühle gerät der Depressionskranke durch das Unwissen seiner Gesprächspartner. Sie versuchen, ihm zuzusprechen: »Du schaffst das schon, wenn du dir nur ein bisschen Mühe gibst«. Dabei will er, er kann nur einfach nicht. Und er weiß, dass der andere das nicht versteht und dann oft ungeduldig wird. Und der Ungeduldige schämt sich seinerseits wegen seiner Ungeduld. Äußerst schädlich ist der »gute Rat« von wohlmeinenden Freunden, sich doch nicht mit Medikamenten vollstopfen und ruhigstellen zu lassen.
Auch wir Angehörige werden oft von der Frage geplagt: Tue ich genug für meinen Patienten? Auf dieses schwerwiegende Problem komme ich im Laufe dieses Buches immer wieder zurück. Auch bei entfernteren
Weitere Kostenlose Bücher