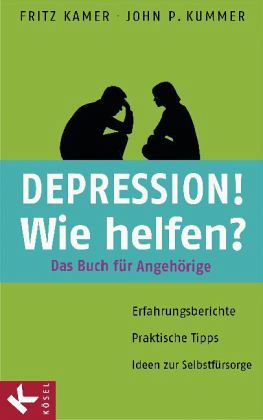![Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige]()
Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige
der Rückschläge, wie sie schließlich in jeder Krankheit vorkommen können, die Gefahr des Frusts, der Selbstzweifel. Geduld ist angesagt, vom Patienten und seinem Betreuer. Aber, um es der Heilskraft der Hoffnung wegen nochmals zu sagen: Dieses Quäntchen »Können« ist in jedem Depressionskranken vorhanden, sonst gäbe es überhaupt keine Heilung.
Hart am Jenseits
Der wohl schlimmste Aspekt einer Depression ist die Nähe des Todes. Dieser ist, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, allgegenwärtig. Über die Hälfte aller Selbstmorde stehen im Zusammenhang mit Depressionen. Da kann der Kranke noch so gottesfürchtig sein, in den allermeisten Fällen wird die Möglichkeit der »Erlösung« in seinen endlosen Grübeleien herumgeistern. Wenn er dazu aus religiösen oder anderen Gründen klare Einwände hat, umso besser, das hilft auch unserem Seelenfrieden. Aber solche Prinzipien können auch umgestoßen werden!
Auch wenn unser Freund, sei es aus Scham oder Liebe, diese Gedanken uns Angehörigen gegenüber nicht äußert, so müssen wir uns doch mit der Möglichkeit beschäftigen und sie dem Kranken gegenüber auch ansprechen. Dies nicht zu tun, »um keine schlafenden Hunde zu wecken« ist nicht sinnvoll, ja unverantwortlich. Die Hunde bellen dem Patienten längst die Ohren voll; und wir können auch hier die Einsamkeit und Verlassenheit, in der er sich fühlt, lindern, indem wir mit ihm sprechen. Damit wir da kein Porzellan zerschlagen, müssen wir versuchen, uns in ihn hineinzuversetzen.
Der Depressive sieht in seinem immensen Schmerz keinen Rückweg ins Diesseits. Hingegen einen Weg »ins bess’re Land«, wie es in der Oper »Die Zauberflöte« verheißen wird: »Endlich Ruhe haben, nichts mehr spüren von den Qualen, es hat ja doch keinen Sinn, ich kann mich nicht wehren, ich Schwächling (!). Ich bleibe drin, falle meinen Mitmenschen zur Last. Falls ich je herauskomme, stürze ich früher oder später doch nur wieder ins selbe Loch«. Wenn wir uns das Ausmaß des Leidens in der Depression vergegenwärtigen, verlieren alle moralischen Einwände und Bedenken ihre Relevanz.
Deshalb dürfen wir nicht zögern, diese »Endlösung« zu thematisieren, auch wenn wir keine konkreten Anhaltspunkte haben. Todesgefahr erlaubt keine falsche Scham.
Falsch ist auch die Annahme, dass Personen, die Suizidgedanken äußern, diese nicht in die Tat umsetzen (nach dem Beispiel der bellenden Hunde). Hier gilt der Grundsatz: Kann sein, muss aber nicht. Irrtümer können tödlich sein.
Was ist mit den Drohungen, die nicht verwirklicht werden, oder den Versuchen, bei denen der »Täter« insgeheim hofft, sie mögen nicht gelingen? Diese werden oft von Menschen unternommen, die einsam sind oder sich missachtet fühlen, und dienen dazu, Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu erregen. Brechen wir nicht den Stab über diese Menschen, auch wenn sie uns mit ihrem Tun auf eine Art einbeziehen und belasten, die eigentlich unethisch ist. Und: Versuche können ungewollt gelingen!
In jedem Fall ist sofortiges Handeln angesagt. Ich komme bei der Frage »Wie helfen?« (siehe S. 117) darauf zurück. – Suiziddrohungen wirken auch sehr direkt auf unsere Psyche als Betreuer, sodass wir uns mit der »Schrift an der Wand« (siehe S. 153 ff.) noch eingehend auseinandersetzen wollen.
Ich wiederhole abschließend: Anzeichen, dass der Depressionsbetroffene mit der »ewigen Ruhe« liebäugelt, sind immer und in jedem Fall ernstzunehmen. Handeln Sie! Und zwar schleunigst.
Der Alltag: Ein anderes Leben
Ein Krankenhaus
Ganz banal: Das Essen wird kalt, wir warten …
Weniger banal: Ich muss mich daran gewöhnen, allein zu essen.
Noch weniger banal: Mir ist der Partner abhanden gekommen.
Das heißt nicht, dass er keinen Hunger hat, dass er auf meine Gegenwart verzichten will, dass er genug hat von mir.
Wie gehen wir damit um? Wie lange warten wir mit dem Essen? Schmeckt es uns auch so? Sind wir lieber allein als in Gegenwart einer Trauerweide?
Das Leben in einem Haushalt mit einem Depressionskranken stellt ganz besondere Anforderungen an uns Gesunde. Der Kranke ist da, ob er nun mit Trauermiene oder steinernem Gesicht in der Wohnung herumschlurft oder sich ins abgedunkelte Zimmer oder ins Bett verkrochen hat. Wir bewegen uns lautlos, wir wagen kaum, Radio zu hören und fragen uns ständig, was der Kranke wohl gerade macht, ob er was braucht, ob wir ihm etwas anbieten sollen.
Alles ist anders. Früher war er der Erste am Morgen, jetzt ist er fast bis
Weitere Kostenlose Bücher