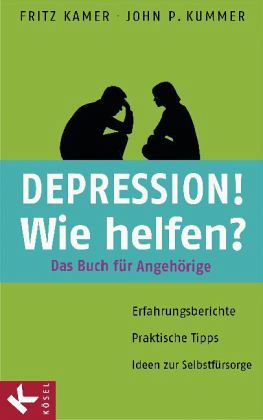![Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige]()
Depression! Wie helfen? - das Buch für Angehörige
wieder ein normales Leben führen, um seine Lebens- und Berufsziele weiterzuverfolgen. Die einem Menschen zugestandene Lebensspanne lässt sich nicht ausdehnen und ist kostbar. Somit ist es wichtig, dass möglichst wenig von dieser Zeit ungenützt verloren geht. Außerdem ist jeder Aufenthalt in einer Depression mit Ängsten und Schmerzen verbunden, von denen man seine Angehörigen möglichst bald befreit sehen möchte.
Früher oder später werden wir ungeduldig. Wir wissen nicht, was wir noch tun können und begeben uns in die Abhängigkeit von einer Depression, die nicht einmal die eigene ist. Und dass man sich nicht anstecken lässt, ist entscheidend, denn man kann seinem Depressionspatienten nur helfen, wenn man selber »normal« funktioniert.
Zur Überprüfung, ob das noch der Fall ist, habe ich die Checkliste Depressionssymptome bei Betreuern zusammengestellt. Ich habe sie bereits im Abschnitt »Blick in den Spiegel« (S. 82 f.) erwähnt und dort postuliert, dass wir beim Vorhandensein von Depressionssymptomen unbedingt Hilfe suchen sollten.
Wir Angehörige gehen über einen schmalen Grat. Es ist schwierig abzuwägen, wie wir reagieren sollen. Ignorieren wir die Reden und das Verhalten des Patienten, fühlt er sich nicht ernstgenommen. Anderseits kann es durchaus sein, dass sich seine Depression noch verstärkt, wenn wir auf ihn eingehen und gar mit Logik zu diskutieren versuchen. Und mittendrin stehen wir mit unserem eigenen Denken und Fühlen. Wir können und müssen nicht über unseren Schatten springen und schweigen zu unsinnigen Argumenten oder haltlosen Beschuldigungen. Wir sind auch Menschen, wir sind gesund und frei in den Gedanken und Gefühlen und müssen es bleiben, uns und dem Betreuten zuliebe.
Was tun auf dem Grat? Sehr oft werden wir frustriert. Wir können tun und sagen, was wir wollen, es ist verkehrt. Versuchen wir, ihn aufzumuntern, argwöhnt er, dass wir ihn nicht ernstnehmen; bedauern wir ihn, versinkt er nur tiefer im Selbstmitleid. Ein Verstummen unsererseits ist aber auch falsch. Wenn wir jedoch herausfinden, was hinter jeder Botschaft des Kranken steckt, können wir auf den wahren Grund seiner Frustration oder seines Ausbruchs eingehen und geben ihm gleichzeitig das Gefühl, ernstgenommen zu werden. Man beschäftigt sich mit ihm. Damit wird er vielleicht mitteilsamer und wir können ergründen, wo der Gesprächshebel anzusetzen ist, wo wir Informationen erhalten, was er wirklich fühlt und denkt. Vielleicht wird er dann ruhiger, kooperativer und damit positiven Botschaften und Vorschlägen zugänglich. So bringen wir ihn vielleicht eher hinter dem Ofen hervor, wenn wir unserem Verständnis für seine Müdigkeit Ausdruck geben, als wenn wir einfach sagen: »Jetzt komm schon!«
Seien wir uns bewusst, dass seine Empfindlichkeit für Vorwürfe sehr hoch ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht auch einmal »Dampf ablassen« dürfen, ja müssen. Bei unserem Verhältnis geht es ja in der Regel nicht um eine Mutter-Kind-Beziehung, sondern um zwei gleichgestellte Menschen – von denen der eine – wir – besser in der Lage ist, sein Verhalten dem anderen gegenüber zu kontrollieren.
Eine bewährte psychologische Methode ist dabei die Ichform. Wir sagen nicht »Du tust« und »Du solltest«, sondern schildern das Problem aus unserer Sicht. Freilich dürfen wir uns nicht als Beispiel darstellen, sonst heißt es bald »Du hast gut reden« und der Erfolg ist gleich null. Ferner sollte unser Reden möglichst präzise sein und sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen. Sätze wie »Immer tust du …« oder »Nie kann man …« sind schon in Beziehungen zwischen Gesunden gefährlich. Konkrete Formulierungen helfen auch, die eigenen Gedanken zu schärfen und nicht in eine Schwarzweißargumentation zu verfallen. Außerdem helfen sie dem Kranken, der die Welt nur mehr in unbestimmtem Grau sieht, wieder Ordnung in seine Gedanken zu bringen und nicht mehr nur allgemein und unscharf zu argumentieren – im Klartext: zu jammern.
Es bleibt uns also das Recht auf unser eigenes Fühlen und Denken. Wir müssen es im Dienste des eigenen Überlebens bewahren. Das hört sich jetzt recht pathetisch an, aber wir haben ein Recht darauf, unser Betreuerleben so angenehm als möglich zu gestalten, ja, wir haben die Pflicht dazu, denn unser Lebensmut und unsere Lebensfreude kommen ja auch wieder dem Kranken zugute.
Es kann sein, dass wir das Gefühl haben, für unsere eigenen Sorgen und Probleme, für
Weitere Kostenlose Bücher