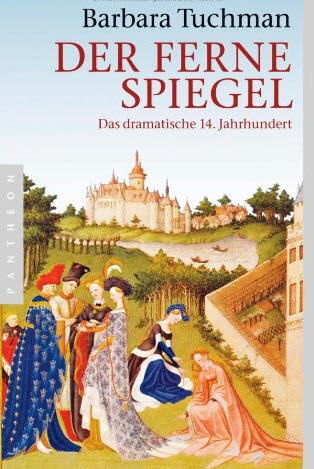![Der ferne Spiegel]()
Der ferne Spiegel
festgehalten) übertraf der Herzog noch den König, indem er ihm ein wertvolleres Geschenk machte, als er der Herzogin gegeben hatte. Die Festlichkeiten wurden mit Singen und Tanzen der Damen und Mädchen zur »Ehre des Königs, des Herzogs von Touraine (Orléans), des Herzogs von Bourbon und des Sire de Coucy« beendet.
Als Karl VI. dann endlich nach Paris heimgekehrt war, wurde das Versprechen, an nichts anderes mehr als an die Wiedervereinigung der Kirche zu denken, zugunsten des verlockenden genuesischen Vorhabens beiseite geschoben. Die Unternehmung gegen das Berberkönigreich war ein vielversprechendes Abenteuer, das zudem nicht großer politischer Umsicht bedurfte, wie es bei der päpstlichen Angelegenheit der Fall gewesen wäre. Ein Kreuzzug brachte immer, auch wenn er wenig mit der Sache des Kreuzes zu tun hatte, einen nicht zu unterschätzenden Prestigezuwachs für seine Teilnehmer, von dem »privilegium crucis« gar nicht zu reden, das sowohl einen Schuldennachlaß als auch ein gewisses Maß von Straffreiheit garantierte. Während die »Flamme der Tapferkeit in allen Herzen entbrannte«, wurden bestimmte Vorsichtsmaßregeln getroffen: Der Rat beschränkte die Zahl der Ritter, die das Land verlassen durften, auf eintausendfünfhundert, und niemand durfte ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Königs gehen. Alle Teilnehmer mußten sich selbst auf eigene Kosten ausrüsten und durften außerhalb ihres eigenen Besitzes keine Gefolgsleute rekrutieren.
Ludwig von Orléans, der seinen Onkel Burgund aus seiner führenden Stellung im Königreich zu verdrängen trachtete, überschüttete einflußreiche Adlige mit Geschenken in der Hoffnung, das Kommando zu erhalten, das er sehr begehrte. Aber der Einfluß seines Onkels war groß genug, um es nicht dazu kommen zu lassen. Als Begründung wurden Ludwigs Jugend und Unerfahrenheit genannt, was die Rivalität noch verschärfte. Der Herzog von Burgund selbst hatte zu viele Interessen im Inland, als daß er bereit gewesen wäre, das Land zu verlassen; Berry war in Ungnade gefallen und ohnedies kein Krieger. So wurde der Herzog von Bourbon auserwählt, der in den Fußstapfen Ludwigs des Heiligen, der an der Küste von Tunis gefallen war, Ruhm suchen wollte. Coucy wurde zu seinem Stellvertreter ernannt. [Ref 356]
Im Stile eines großen Fürsten stiftete Coucy vor seinem Aufbruch eine Kirche und ein Kloster. Da das geistige Leben als dem weltlichen überlegen betrachtet wurde, war die Gründung eines Klosters eine Möglichkeit, am Verdienst der Kirche teilzuhaben. Und wie der Herzog von Burgund anläßlich der Gründung eines Kartäuserklosters 1385 in Champmol gesagt hatte: »Für die Erlösung der Seele sorgt nichts so sicher wie die Gebete frommer Mönche. «
Coucy wählte für seine Stiftung den Zölestinerorden, der paradoxerweise wegen seiner strengen Enthaltsamkeit bei dem so überaus weltlichen Adel sehr beliebt war. Aber war die Wahl wirklich paradox, oder deutete sie auf ein schlechtes Gewissen und ein Reuebedürfnis angesichts einer Lebensform hin, die sich so weit von den Prinzipien, zu denen es sich bekannte, entfernt hatte? Die Dualität eines Lebens unter dem christlichen Glauben zeigte sich in der Person des Herzogs von Orléans, den es von Lustbarkeit, Reichtum und politischem Intrigenspiel immer wieder zu den steinernen Nachtwachen in das Zölestinerkloster zog. Die Genügsamkeit der Mönche zu teilen hieß, die eigene Selbstverachtung zu vergessen.
Welchen Trost der christliche Glaube auch immer spenden mochte, er wurde aufgewogen durch die Angst, die er hervorrief. In dieser Angst hatte Chaucer gegen Ende seines Lebens sich gezwungen gefühlt, mit der Schlußstrophe des Parson’s Tale sein Lebenswerk
zu »widerrufen«: die Canterbury Tales , Troilus and Criseyde , The Book of the Duchess und alle Gedichte, die nicht fromm waren. Er bat Christus, ihm diese »weltlichen Eitelkeiten« zu vergeben, »so daß ich am Tage des Jüngsten Gerichts einer von denen sein werde, die errettet werden«. Dem Christentum mußte eine tragische Macht innewohnen, wenn es einen Mann dazu bringen konnte, seine eigenen Schöpfungen zurückzunehmen.
Der Gründer des Ordens der Zölestiner im 13. Jahrhundert hatte schon zu Jugendzeiten in einer Höhle das Leben eines Einsiedlers geführt, um sich Gott ganz zu ergeben. Er hatte versucht, seine Fastenübungen so weit zu treiben, wie es sein Körper eben noch zuließ. Sechzehn Stunden hatte er täglich betend verbracht, er trug
Weitere Kostenlose Bücher