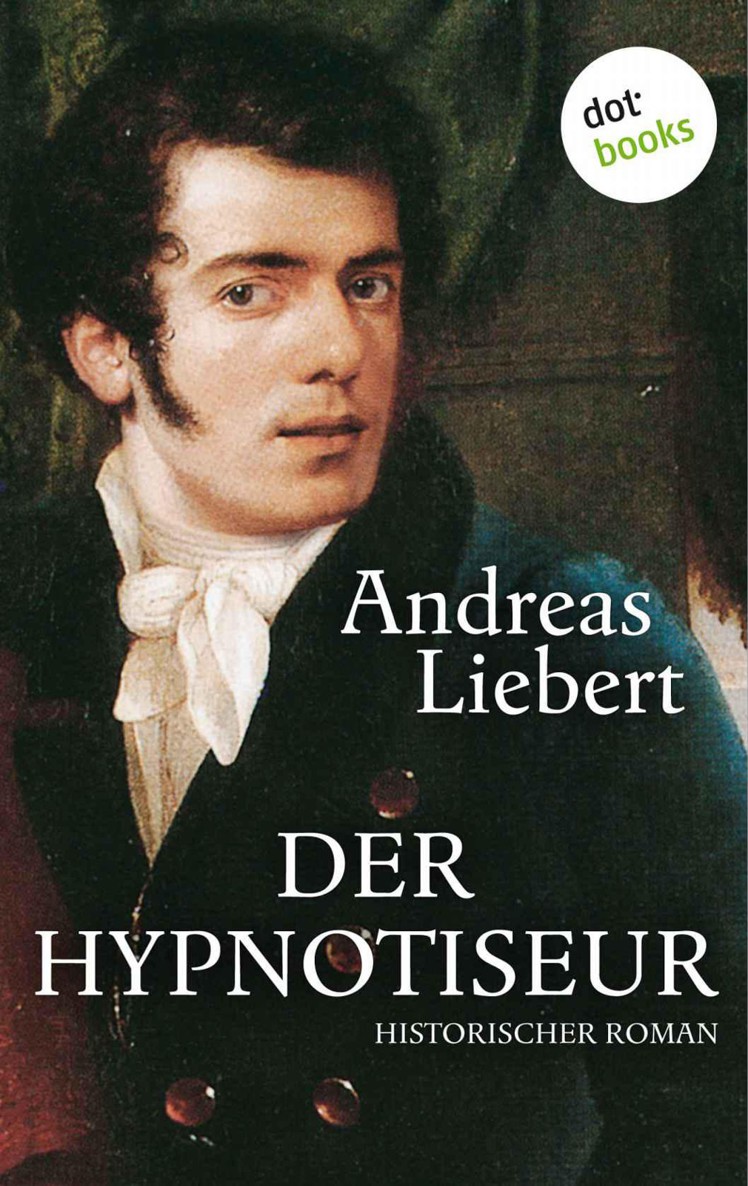![Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)]()
Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)
bis zum Montag, dem Tag meines nächsten Besuchs, darüber nachzudenken. „Ich möchte deine Meinung hören", sagte ich ernst.
»Wenn du alles anders siehst, ist es dein gutes Recht. Aber ich verlange, dass du dich deutlich erklärst.«
Bürgermeister Soulé war natürlich neugierig, was diese erste Sitzung gebracht hatte. Ich erklärte ihm, erst müsse ich das völlige Vertrauen des Jungen erworben haben, aber auch dann würden Fortschritte nur in kleinen Schritten kommen.
»Sébastien ist im übrigen nicht besonders suggestibel. Ich werde die nächsten Tage versuchen, ihm die Scheu vor seiner Schwester zu nehmen. Ich werde ihn bitten, sich vorzustellen, wie niedlich sich Esthers patschige Hand anfühlt und wie schön es ist, wenn sie einen streichelt.«
Der Bürgermeister nickte begeistert. Diese Art von Therapie gefiel ihm. Ich aber hatte ein ungutes Gefühl. Mein Instinkt sagte mir, dass ich irgend etwas falsch gemacht hatte.
Bloß - was?
Noch immer saß ich im Restaurant. Der Apfelkuchen war längst verzehrt. Ich winkte nach dem Wirt. Diesmal jedoch war ich so in Gedanken versunken, dass ich vergaß, das Glas Champagner einzufordern – das ich bislang selbstverständlich nie bezahlt hatte. Nicht zuletzt deswegen hatte ich mir ja das Le Petit Bon zu meinem neuen Lieblingsrestaurant auserkoren, denn der Wirt zählte zu den hochsuggestiblen Personen. Hatte ich bezahlt, brauchte ich den Wirt nur anzuschauen und zu sagen: Monsieur Poulenc, und mein Glas Champagner? Es genügte, das Wort Champagner dreimal zu wiederholen, und schon nickte der Wirt, eilte an die Theke und öffnete eine Flasche. Bislang hatte ich Monsieur Poulenc jedesmal gebeten, ein Glas mitzutrinken, denn ich hatte es mir zur eisernen Regel gemacht: Wenn ich mir schon auf Kosten anderer einen Streich erlaube, muss derjenige auch etwas davon haben.
»Kein Glas Champagner, heute?«
»Oh. Bin ich so in Gedanken? Ich bilde mir ein, Sie hätten es mir längst serviert, Monsieur Poulenc.«
»Nein. Wo denken Sie hin!«
»Monsieur Poulenc! Aber ich habe ihn doch noch auf der Zunge. Als ob ich Ihren Champagner vergessen könnte. Schließlich schenken Sie den besten Champagner im ganzen Arrondissement aus. Nein, ich habe meinen Champagner getrunken.«
»Ja, sicher.«
»Sehen Sie.«
Ich erhob mich, ließ den Wirt jedoch nicht aus den Augen. Monsieur Poulenc verbeugte sich und begleitete mich zur Tür. Doch plötzlich stutzte er: „Nein“, rief er und es klang, als sei er sehr böse auf mich. »Sie können unmöglich Champagner bekommen haben! Schließlich habe ich ja nicht mitgetrunken! Überhaupt, wo ist die Flasche? Was machen Sie mich bloß konfus heute, Monsieur! Warten Sie, ich beweise es Ihnen.«
Monsieur Poulenc eilte an den Tresen, derweil sah ich zu, dass ich fortkam. Offensichtlich hatte ich in den letzten Wochen mein weiches Herz gegen das eines Hasenfußes vertauscht – also, ich nahm die Beine in die Hand, bog in die Rue de la Callandre ab und verschwand an der nächsten Ecke in eine dunkle Gasse. Hier auf der Cité-Insel waren die alten, mittlerweile abgerissenen Häuser von atemberaubender Höhe. Angesichts der fünf, sechs, ja zuweilen sogar sieben Stockwerke, spottete ein Chronist aus dem letzten Jahrhundert, könne man glauben, dass etliche Pariser sich ihren Lebensunterhalt offensichtlich als Sterndeuter verdienten. Nur im Hochsommer fiel etwas Licht in die blinden, dreckigen Fenster, und entsprechend schneidend war die Luft. Die Menschen, die hier wohnten, waren abgestumpft und gleichgültig.
Ich zog den Kopf zwischen die Schultern, denn es war gang und gebe, dass Mansarden- und Speicherbewohner sich der Dachtraufen bedienten, um ihren Unrat auszuleeren. Spazierte man im falschen Moment an der falschen Stelle konnte es passieren, dass eine kloakenhaften Dusche auf einen herabprasselte. Sich zu beschweren war sinnlos. Denn was in den Dachrinnen und Fallrohren gelandet war, konnte offiziell nicht aus dem Fenster geschüttet worden sein.
Zum Glück war die Gasse nicht lang. Seineabwärts über die Rue St. Louis gelangte ich über den Quai des Orfèvres auf die Pont Neuf mit dem damals gar nicht mehr glänzenden Reiterstandbild Heinrichs IV. Hier atmete ich auf, richtete mir das Halstuch und überprüfte meine Schuhsohlen. Das plötzlich wieder schöne Spätherbstwetter hatte die Pariser scharenweise ins Freie getrieben. Parks und Boulevards glichen Aufmarschplätzen modebewusster Damen und Gecken. Eine Symphonie aus
Weitere Kostenlose Bücher