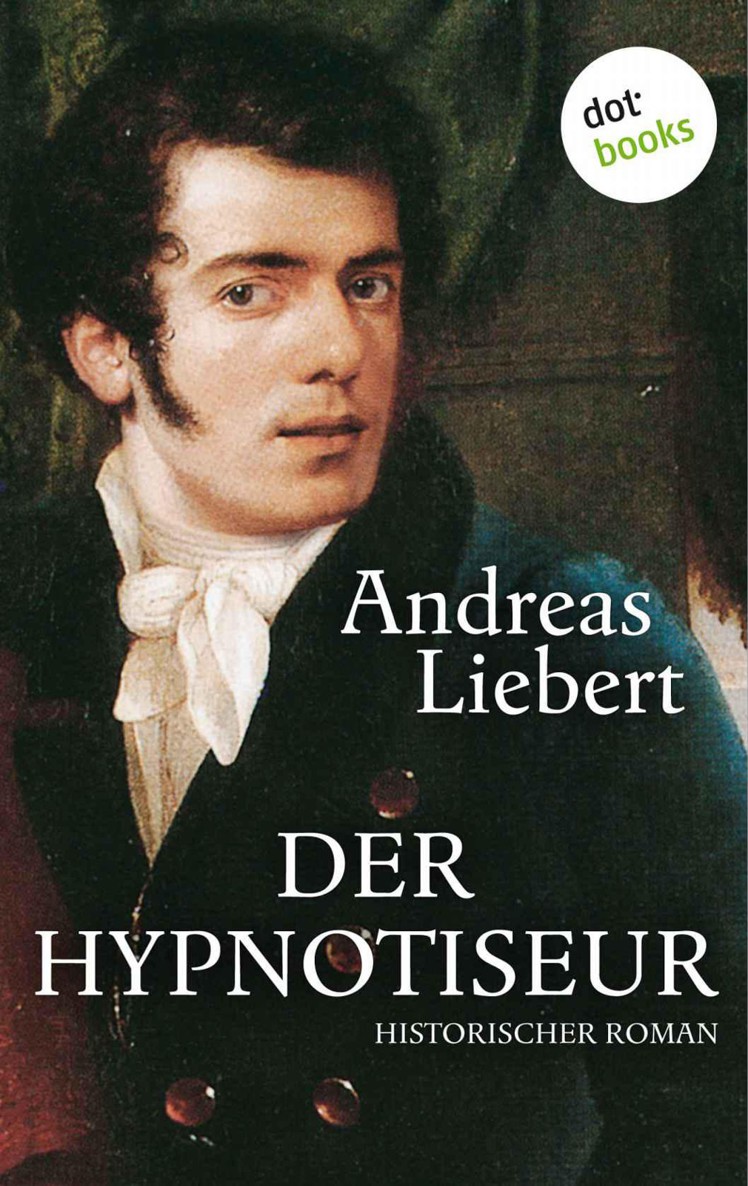![Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)]()
Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)
Halsbräune. Den Alten rasselte die Brust, riss es an den Gliedern, und sie klagten entweder über Verstopfung oder Durchfall. Mägde torkelten schwanger im neunten Monat in die Praxis, den Leib flach geschnürt und bereits in den Wehen. Dann wieder kamen Ehefrauen, die gehört hätten, es gäbe etwas, was man sich „reintun“ könne, um nicht mehr schwanger zu werden.
Dann die Unfälle: abbinden, schienen, nähen. Offene Wunden, an deren Rändern Maden zitterten, vereiterte Verbände hart wie Gips. Ließ sich damit umgehen, kostete die psychologische Betreuung die meisten Nerven. Ich erinnerte mich gut: Zum Beispiel an Madame A. mit den ausgeprägten Labialfalten und dem silbergrauen Haar – stellvertretend für so viele andere kam sie mit der ständigen Anklage, Onkel Jean würde zu wenig verschreiben, dazu das Falsche und zu teuer sei es auch. Ständig wusste sie von „anderen“ zu erzählen, die viel wirkungsvollere Senfpflaster bekämen, mildere Purgative, stärkendere Tränkchen. Dann Madame B. aus Toulouse: Sie verwies bei jedem Besuch auf Zeitungsinserate und keifte, warum „in diesem“ Hospital der Fortschritt so auf sich warten lasse und die „neuen Arzneien“ noch nicht erhältlich seien. Oder Monsieur R. in Lyon, der, weil er die Enzyklopädie geerbt hatte, jegliche Verordnung benörgelte und alle Ärzte kollektiv als Restaurations-Fanatiker beschimpfte. Nicht zu vergessen die Resignierten: Sie glaubten fest, dass der Tod sie bald holen würde, und verfielen entweder in vollständige Lethargie oder stürzten sich erst recht in aufreibende Geschäfte und ausschweifende Leidenschaften, um am Ende nicht an einem Magengeschwür zu sterben, sondern an der Englischen Krankheit.
Wie bunt erst würde es hier in Paris werden! Diesem Tummelplatz aller selbstgerechten Individualisten und Hypochonder, der Stadt mit den meisten Besserwissern? Ich versuchte mir vorzustellen, wie es war, nachts um zwei zu einer aufgeregten Madame de XYZ gerufen zu werden, deren fettgefressener Gatte plötzlich Nasenbluten bekommen hatte, oder einem Bankier morgens um sieben die eigentlichen Gründe auseinandersetzen zu müssen, warum die Unpäßlichkeit der werten Gattin statt fünf Tagen im Monat seit neuestem fünf Wochen daure. Denn egal wie angesehen ein Arzt in Paris war, letztlich war jeder nur ein subalternes Subjekt, dem höflich oder unwirsch bedeutet wurde: Wir bezahlen dich, folglich helfe! Je reicher die Patienten waren, um so größer die Beschwernisse mit ihnen. Denn wenn Geld keine Rolle mehr spielte, meinten die Reichen ein Anrecht auf Gesundheit zu haben. Sie glaubten, in ihren Stadtvillen einen sakralen Bezirk zu bewohnen, in dem der Arzt bloß seinen Zauberstab schwingen müsse. Sie erwarteten von seinen Rezepten eine Art Garantie, weil sie dafür ja gut bezahlten, benahmen sich ansonsten jedoch ungeheuer aufgeklärt. Saß ihnen aber wirklich der Tod im Nacken, schlotterten sie vor Angst und boten vollmundig obszöne Summen zur Spende an, wenn man ihnen nur helfe.
Ein scharfes Knirschen befreite mich vom hypnotischen Fließen der Seine. Ein hoher Kastenwagen mit klobigen Rädern rollte vorüber. Auf seiner Rückseite prangte ein magisches Auge, das in einen nächtlichen Sternenhimmel gemalt war. Unter ihm kreuzten sich zwei Flammenschwerter, auf denen zwei Totenschädel gespießt waren.
»Macht mich auch nicht klüger«, murmelte ich und setzte meinen Weg fort.
Ich ging die Seine-Quais bis zum Boulevard Henri IV. hinauf, wo ich mich entscheiden musste: Rechts ging es über den Fluss zurück nach Haus, links würde ich auf die Plaçe de la Bastille gekommen, von der es nicht mehr weit in die Rue de Bretagne und damit zum Hôtel de Carnoth war. Ich beschloss am Wasser zu bleiben. Doch schon im nächsten Moment war es mir an den Quais zu laut. Die Droschken rollten mit einem Tempo über das Pflaster, als seien die Kutscher allesamt vom schnellen Bibi angesteckt worden. Luftzug auf Luftzug erFasste mich, und jeder stank nach Pferdeschweiß und Wagenschmiere. Das Peitschenknallen drang in meine Gedanken und Empfindungen, bis ich irgendwann glaubte, die Spitzen der Peitschen im Gehirn zu spüren.
Es könnte stimmen, was Frédéric erzählt hat, dachte ich. Wenn mir schon das Peitschenknallen im Hirn schmerzt, dann könnte auch ein guillotinierter Kopf noch dreinschauen, als spüre er die alleszermalmende Schneide des Messers. Erbost zeigte ich einem der Jünger Bibis den Vogel, als ich den Boulevard
Weitere Kostenlose Bücher