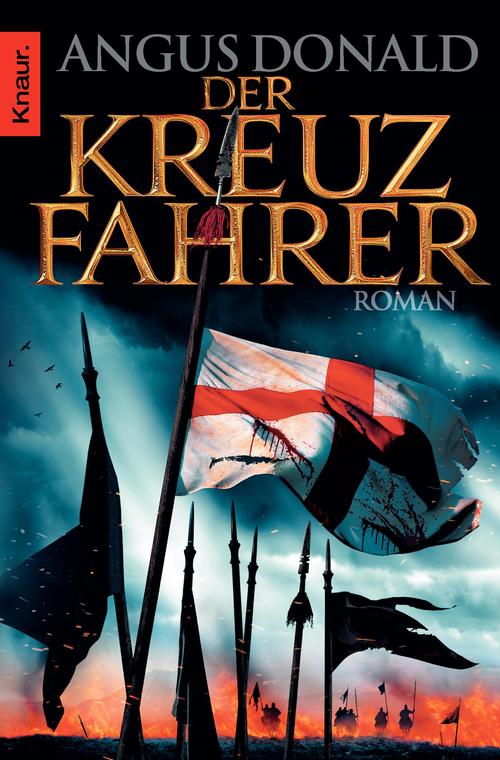![Der Kreuzfahrer]()
Der Kreuzfahrer
Mahlstrom aus Wasser und kreischendem Wind, von den anderen Schiffen war nichts mehr zu sehen. Wir wurden mit beinahe unglaublicher Geschwindigkeit dahingeweht, überragt von gewaltigen Wellenbergen. Die Soldaten und Seeleute jammerten und weinten vor Angst und flehten Gott um Erbarmen an, doch davon hörte ich immer nur kurze Wortfetzen, ehe die nächste Welle gegen den Schiffsrumpf krachte. Ich bekreuzigte mich und bereitete mich so gut wie möglich auf den Tod vor. Mit salzig-nassen Lippen murmelte ich immer wieder das
Ave-Maria
und flehte den Allmächtigen an, in seiner unendlichen Güte das Leben meiner geliebten Nur zu retten, wo auch immer sie in dieser wogenden Hölle sein mochte. Vielleicht wäre dann auch noch etwas Güte übrig, um die Männer, mich eingeschlossen, an Bord dieser jämmerlichen Nussschale zu verschonen, die nach der heiligen Mutter seines geliebten Sohnes Jesus Christus getauft war.
Die ganze Nacht lang tobte der Sturm, das Schiff wurde wie ein Blatt im Wind herumgewirbelt, und ich verlor jegliches Zeitgefühl. Elend hockte ich da, an eine hölzerne Strebe geklammert, klatschnass und durchgefroren – das schützende Stück Segeltuch war mir längst von einer heulenden Sturmböe entrissen worden. Ich rechnete jeden Augenblick damit, dass das Schiff sinken und eine schwarze Wand aus Wasser mich unter sich begraben und meinen Schmerz ertränken würde. Doch Gottes Gnade bewahrte uns vor dem Schiffbruch. Und am Morgen ging eine blasse, wässrige Sonne im Osten auf. Ich hob den kläglich eingezogenen Kopf und stellte fest, dass das Unwetter wundersamerweise vorübergezogen war. Unser tapferes Schiff eilte vor dem frischen Westwind übers Wasser, immer noch beängstigend schnell – aber jetzt pflügte die
Santa Maria
selbstsicher durch große, grüne Wogen, und es wehte nur noch feine Gischt über die Reling, wenn sie auf eine Welle traf. Ein Mann war über Bord gegangen und verloren, ein Seemann, der tapfer versucht hatte, ein flatterndes Tau wieder festzumachen. Da hatte sich ein ungeheuerlicher Wasserschwall über die Reling ergossen und ihn ins Verderben gerissen. Doch abgesehen von dieser armen Seele, war uns nicht viel geschehen. Wir sprachen gemeinsam und mit ganzem Herzen ein Dankgebet, und ich erkannte, dass es grundfalsch von mir gewesen war, auch nur einen Augenblick lang an Gottes Gnade zu zweifeln. Ich hätte wissen müssen, dass er uns retten würde: Wir unternahmen diese Reise, um sein Werk zu tun und die Wiege des Christentums zu retten. Wir spülten uns den Mund mit Trinkwasser aus, schälten uns die klatschnasse Kleidung vom Leib und begannen, nach den anderen Schiffen unserer Flotte Ausschau zu halten.
Während der Himmel aufklarte und die See noch ruhiger wurde, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass viele der anderen Schiffe noch zu sehen waren, wenn auch weit entfernt. Sie waren in alle Himmelsrichtungen über das bewegte Meer verstreut, so weit das Auge reichte, doch sie hielten sich tapfer auf dem Wasser. Wahrhaftig schien es, als hätte die Hand Gottes uns vor dem zornigen Wüten des Teufels geschützt. Und das Beste, das Wunderbarste an diesem Morgen war, dass ich steuerbords in knapp zwei Dutzend Meilen Entfernung eine gedrungene, gräulich grüne Landmasse erkennen konnte: die Insel Kreta.
Wir verbrachten zwei Tage im alten Hafen von Heraklion auf Kreta, erholten uns von dem Erlebten und warteten darauf, dass sich der Rest der Flotte versammelte. Zwar schliefen wir an Bord, doch wir hatten auch Gelegenheit, an Land zu gehen und Proviant und frisches Trinkwasser aufzunehmen – der Großteil unserer Vorräte war durch eindringendes Meerwasser während des Sturms unbrauchbar geworden. Ich heuerte einen einheimischen Bootsmann an und besuchte Robin, Little John und Reuben auf ihrem Schiff, der
Holy Ghost.
Von ihnen erfuhr ich, dass die meisten unserer Kämpfer wohlauf waren und wir nicht mehr als ein Dutzend Männer verloren hatten – keinen von ihnen hatte ich näher gekannt. Einer unserer Gefährten, ein scheinbar gefestigter Soldat aus Yorkshire, hatte während des Unwetters offenbar den Verstand verloren und versucht, den Kapitän seines Schiffes umzubringen, ehe er sich selbst ins Meer gestürzt hatte. Doch der Großteil unserer Streitmacht war unversehrt und schaukelte sacht im Hafen von Heraklion. Trotzdem war ich krank vor Sorge, denn seit dem Sturm waren etwa zwanzig Schiffe verschollen, darunter auch die prächtig ausgestattete königliche
Weitere Kostenlose Bücher